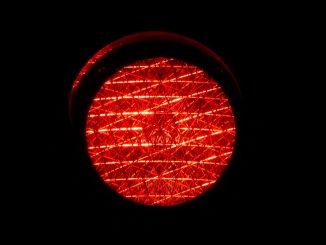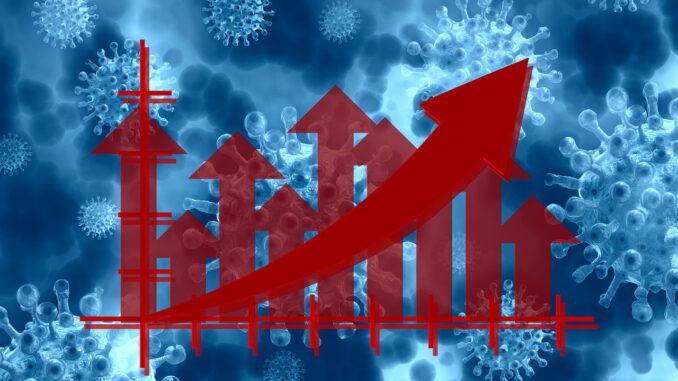
YouGov Sonntagsfrage: Die Union nur noch knapp vor der AfD +++ Zweifel an Merz wachsen +++ Bürgerinnen und Bürger blicken differenziert auf Corona zurück
Zur Wahlabsicht, zur Wahrnehmung von Friedrich Merz und einer möglichen schwarz-roten Koalition sowie zur Wahrnehmung der Corona-Politik
Die erste YouGov Sonntagsfrage nach der Bundestagswahl 2025 zeigt eine zunehmend fragmentierte Parteienlandschaft und eine erstarkende AfD. CDU/CSU kommen auf 26 Prozent und verlieren damit knapp 3 Prozentpunkte im Vergleich zum Ergebnis bei der Bundestagswahl. Die AfD notiert bei 24 Prozent, ein Plus von 3 Prozentpunkten gegenüber der Bundestagwahl. CDU/CSU und AfD trennen im Moment nur noch 2 Prozentpunkte.
Hinter CDU/CSU und AfD bilden SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke ein breites Mittelfeld. Die SPD liegt bei 15 Prozent (1 Prozentpunkt weniger als bei der Bundestagswahl). Bündnis 90/Die Grünen bleiben gegenüber ihrem Wahlergebnis unverändert bei 12 Prozent. Die Linke gewinnt gegenüber der Bundestagwahl einen Prozentpunkt hinzu und landet bei 10 Prozent.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht kommt auf 5 Prozent (unverändert im Vergleich zum Bundestagswahlergebnis). Die FDP landet bei 3 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als bei der Wahl im Februar. Sonstige Parteien liegen bei 4 Prozent.
Das ist das Ergebnis der aktuellen YouGov-Sonntagsfrage, für die 1.890 Personen von insgesamt 2.144 wahlberechtigten Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmern ihre Wahlabsicht abgegeben haben. Die Wahlabsicht gehört laut DSGVO zu den sensiblen personenbezogenen Daten und darf daher in YouGov-Umfragen übersprungen werden. Die Befragung fand zwischen dem 21. und 24.03.2025 statt.
Keine Zuversicht: Ein Drittel glaubt, dass Schwarz-Rot Lebensbedingungen verschlechtern wird
CDU, CSU und SPD haben die erste Phase der Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Das, was Wahlberechtigte bislang über die Abstimmungen zwischen CDU, CSU und SPD wissen, hat die Stimmung in Deutschland noch nicht verbessern können. Fast ein Drittel (30 Prozent) glaubt, dass sich ihre Lebensbedingungen unter einer schwarz-roten Koalition verschlechtern würden. Nur knapp jede und jeder Zehnte (9 Prozent) denkt, dass Schwarz-Rot ihre oder seine Lebensbedingungen verbessern würde. Rund die Hälfte (49 Prozent) der Wahlberechtigten erwartet, dass eine schwarz-rote Koalition ihre Lebensbedingungen weder verbessern noch verschlechtern würde.
Bürgerinnen und Bürger glauben nicht, dass Schwarz-Rot Deutschland auf die richtige Spur bringen kann. Nur jede und jeder Zehnte (9 Prozent) traut Schwarz-Rot zu, die wichtigsten Probleme in Deutschland lösen zu können. Jede und jeder Dritte (34 Prozent) traut das Schwarz-Rot auf keinen Fall zu, weitere 51 Prozent nur zum Teil.
Zweifel an Merz wachsen – auch unter Unions-Anhängerinnen und -Anhängern
Die Diskussionen um die Lockerung der Schuldenbremse und der aktuelle Stand bei den Koalitionsverhandlungen mit CSU und SPD haben dazu geführt, dass die Öffentlichkeit diskutiert, ob Friedrich Merz für das Amt des Bundeskanzlers geeignet sei. Aktuell hält ein Drittel der Wahlberechtigten (32 Prozent) Merz für geeignet als Bundeskanzler. Das sind 10 Prozentpunkte weniger als noch bei unserer Befragung vom 14. bis 17. Februar 2025, also wenige Tage vor der Bundestagswahl (42 Prozent). Mehr als die Hälfte (57 Prozent) glaubt aktuell, dass Friedrich Merz nicht als Bundeskanzler geeignet ist. Auch dieser Anteil ist im Vergleich zum Februar gestiegen (52 Prozent).
Die Zweifel an Friedrich Merz sind unter Unions-Anhängerinnen und -Anhängern wieder so hoch wie zuletzt im Dezember 2024. Aktuell halten 78 Prozent der Unions-Anhängerinnen und -Anhänger Friedrich Merz für geeignet als Bundeskanzler, 17 Prozent für nicht geeignet. Im Februar 2025 hielten ihn noch 89 Prozent für geeignet und nur 9 Prozent für nicht geeignet. Damit hat Merz den Zuspruch, den er sich während des Bundestagswahlkampf erarbeitet hatte, wieder eingebüßt. In der YouGov-Befragung vom 17. bis 20. Dezember 2024 hielten ihn 75 Prozent geeignet, und 21 Prozent für nicht geeignet als Bundeskanzler.
Bürgerinnen und Bürger sind im Rückblick unzufrieden mit der Corona-Politik – bewerten aber Corona-Maßnahmen differenziert
Im März 2020 kam es in Deutschland zum ersten Lockdown der Corona-Pandemie. Wahlberechtigte in Deutschland sind uneins, wenn es darum geht, die Corona-Politik in Deutschland rückblickend zu bewerten. Eine knappe Mehrheit (53 Prozent) sagt, dass sie mit der damaligen Politik unzufrieden ist, während etwa vier von zehn Befragten (41 Prozent) sagen, dass sie rückblickend mit der Politik zufrieden sind.
Zur Eindämmung der Pandemie traten im März 2020 weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft, die von Bund und Ländern beschlossen wurden. Wahlberechtigte bewerten im Rückblick die unterschiedlichen Maßnahmen differenziert, die zur Eindämmung der Pandemie eingesetzt wurden. Wahlberechtigte stufen die Schließung von Schulen und Kitas mehrheitlich als unangemessen ein (52 Prozent), ebenso das Besuchsverbot in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen (51 Prozent). Andere Maßnahmen, wie Zugangs- und Kontaktbeschränkungen nach 3G (43 Prozent), Impfregeln (40 Prozent) oder die Schließung von Freizeiteinrichtungen wie Kinos und Restaurants (38 Prozent), finden im Rückblick weniger Ablehnung. Ein anderes Bild zeigt sich bei der Maskenpflicht und den Abstandsregeln. Diese werden nur von jedem fünften Wahlberechtigten (20 Prozent) als unangemessen empfunden.
Betrachtet man nur die jüngsten Befragten, so bewerten diese die Schließungen von Schulen und Kitas anders: Als einzige Gruppe bewerten die heute 18-29-Jährigen die Schulschließungen häufiger als angemessen (53 Prozent) anstatt als unangemessen (37 Prozent).
Bürgerinnen und Bürger sind in unterschiedlicher Art und Weise von Langzeitfolgen betroffen. Die Hälfte (50 Prozent) gibt an, dass die Corona-Pandemie bis heute Auswirkungen auf ihr Leben hat. Ein Viertel (25 Prozent) bezeichnet diese Auswirkungen als überwiegend negativ, 22 Prozent als in etwa ausgewogen. Nur wenige (3 Prozent) bewerten die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihr persönliches Leben als überwiegend positiv. 44 Prozent geben an, dass die Corona-Pandemie bis heute keine Auswirkungen auf das persönliche Leben hat. Bürgerinnen und Bürger nehmen am häufigsten Auswirkungen auf die mentale (23 Prozent) und die physische Gesundheit / Fitness (24 Prozent) als negativ wahr.
Wählerinnen und Wähler der AfD bei der Bundestagswahl 2025 geben am häufigsten an, dass die Auswirkungen überwiegend negativ waren (35 Prozent). Es folgen Wählerinnen und Wähler der Linkspartei (25 Prozent) und des BSW (26 Prozent). Am seltensten bewerten Wählerinnen und Wähler der Grünen (17 Prozent) die Auswirkungen der Pandemie auf ihr persönliches Leben als überwiegend negativ, gefolgt von SPD (18 Prozent) und CDU/CSU (19 Prozent).
Auf die Frage, ob Deutschland im Falle einer erneuten Pandemie besser, schlechter oder etwa gleich gut aufgestellt wäre wie bei der Corona-Pandemie im März 2020, antwortet etwa ein Drittel (30 Prozent), dass Deutschland besser aufgestellt wäre, etwas weniger als die Hälfte (42 Prozent), dass Deutschland etwa gleich gut aufgestellt wäre und knapp jede / jeder Siebte (15 Prozent), dass Deutschland schlechter aufgestellt wäre.
Diese Umfrage wurde von YouGov Deutschland als YouGov Surveys Eigenstudie im YouGov Omnibus Politik durchgeführt. Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des unternehmenseigenen YouGov Panels. Die Mitglieder des Panels haben der Teilnahme an Online-Interviews zugestimmt. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 21. bis 24.03.2025 insgesamt 2.144 Personen in einer repräsentativen Stichprobe, quotiert nach Alter, Geschlecht, Region, Wahlverhalten, Bildung und politisches Interesse, befragt. Die Stichprobe bildet die Wahlberechtigten Deutschlands ab 18 Jahren hinsichtlich dieser Quotenmerkmale ab.