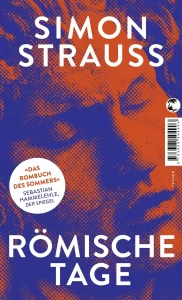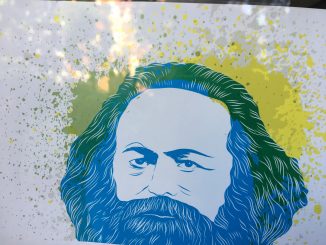Simon Strauss. Tropen. Zu Zweit. Novelle. Stuttgart (Cotta’sche Buchhandlung) 2023, 157 S., ISBN978-3-608-12143-8
Der erste Blick auf die Untertitel und die Gestaltungsmittel des Hard-Cover-Bandes hinterlässt gewisse Irritationen: Es sind Tropen als semantische Figuren, die ein ganzes Handlungsgefüge definieren, und Leitlinien, die mit dem als Novelle bezeichneten Text gewisse Hinweise auf den Plot liefern. Dazu die Garnierung auf dem Umschlag des schmalen Bändchens: einander sich kaum berührende lilafarbige Stränge. Und dann der Vorspann zur Lektüre des Textes. Er verdichtet die Spannung mit einem Zitat aus einem Gedicht von Matthias Claudius, in dem Sachen belacht werden, „weil unsre Augen sie nicht sehen.“ Und: mit einem Textdeutungsversuch des Autors, der jede Begegnung von Menschen als ein kleines Wunder bezeichnet, das sich dann aber dessen Deutung entzieht, wenn am Ende der Beziehung auf einem Grabstein steht, sie seien zu zweit gewesen.
Kein Zweifel, Simon Strauss, Spiegel-Journalist und Autor von zwei Aufsehen erregenden Büchern („Sieben Nächte“, „Römische Tage“) und einer polemischen Doku zum neuen Theater hat mit der vorliegenden Novelle einen Text vorgelegt, der durch eine Reihe ungewöhnlicher Merkmale den Leser gleich zu Beginn in eine spannungsgeladene Neugier versetzt. Es sind fünf Ortsangaben, die gleichsam als Topoi die Handlung des Bändchens strukturieren: Zimmer-Stadt-Fluss-Land-Haus. Sie strukturieren als Flussdiagramm den Handlungsstrang. Und der setzt mit einer ungewöhnlichen Beschreibung eines jungen Manns ein, der schlaflos in einer Dachkammer einem heftigen Regenguss lauscht. Er ist von Visionen und Erinnerungen gequält, wird plötzlich durch ein heftiges scharrendes Geräusch von Katzenkrallen hellwach, während ihn zugleich eine Flut von Erlebnissen und traumatischen Erinnerungen quält. Die langjährige Freundschaft mit Florian, die verstörende Kindheit in einem Elternhaus, in dem der Vater seine Probleme „wie die Leerstellen in seinen Kreuzworträtseln“ löste, die Mutter sich dem Ehedrama durch Flucht mit ihrem Liebhaber entzog und der Junge nach dem dramatischen Freitod des Vaters das Teppichgeschäft der Eltern übernimmt. Er erhält nunmehr von dem auktorialen Erzähler der Novelle die Bezeichnung Verkäufer. Es ist ein einsamer junger Mann, der nur noch seinen immer spärlicher werdenden Kunden gegenüber eine geschäftsbedingte Freundlichkeit zeigt, sich immer mehr seiner Umwelt gegenüber verschließt, so lange bis … eine junge Frau „in einem roten Wollkragenkleid aus Wolle“ in seinem Geschäft auftaucht, die er staunend betrachtet, ihren wirkungsvollen Auftritt als Teppich- und Gardinen-Verkäuferin bewundert, ohne ins Gespräch mit ihr zu kommen. Erst die Sehnsucht nach ihr lässt ihn handeln, doch seine verzweifelten Telefonanrufe erweisen sich als vergeblich – die Vertreterin ist untergetaucht, während der Verkäufer, gelenkt von seinem auktorialen Erzähler, durch eine überflutete Stadt watet, deren Bilder ihm wohlvertraut sind, obwohl sie immer wieder von Erinnerungen an seine Schulzeit und von bizarren Visionen überlagert werden. Je länger der Leser diesem mäanderartigen Bilderstrom folgt, je mehr er mit seinem Protagonisten durch leere Wohnungen streift, von kurzweilig auftauchenden Katzen überrascht wird, verständnislose Blicke mit einem plötzlich auftauchenden Mädchen wechselt, desto mehr vermischen sich die textlichen Botschaften mit den immer rätselhafter werdenden „Bildern“ in der Rezeption durch den Leser. Doch auch der Protagonist entzieht sich seinem Leser, in dem er sich in die Fluten eines Flusses stürzt … und auf einem Floß landet, auf dem „die Gestalt einer jungen Frau zu sehen“ ist. Es ist die Vertreterin, die auch auf der Flucht vor etwas ist, was zunächst nicht wahrnehmbar ist und sich erst in der folgende Erzählpassage des Protagonisten herauskristallisiert. Im Gegensatz zu den Erzählstrukturen in den Topoi 1 und 2 verstärkt sich der Anteil der Personen, die in der Erinnerung des jungen Mädchens in wörtlicher Rede zuweilen etwas zum Ausdruck zu bringen, was ihr gleichsam leitmotivisch plötzlich einfällt. Der Onkel, der das Schreckbild des stummen Menschen vor Augen hält: „Wer nicht redet, der trocknet innerlich aus“ und ihre Mutter, die ihr zuflüstert: „Siehst du, wie schön es ist, nicht allein zu sein.“ In diesen Stunden, während sie auf dem Floß durch die überflutete Stadt treibt, erfährt der Leser endlich etwas über ihre Jugendzeit, erfährt etwas über ihr eigenwilliges Verhältnis zu Männern, die sie, wie der Erzähler behauptet, „nie gebraucht … hatte, aber die Männer brauchten sie.“ Spätestens an dieser Stelle des Erzählplots kristallisiert sich ein Lösungsweg auf dem verworrenen Weg hin zum „zu zweit“ heraus. Aus einem Kleiderhaufen in der Kajüte lösen sich die Konturen eines menschlichen Körpers, den die erschrockene Floßbesitzerin erst dann in ihr Gedächtnis einordnen kann, als sie eine ihr bekannte Stimme flüstern hört: „Das kann doch nicht wahr sein.“ Doch der Wiederkennungsprozess verzögert sich, weil rings um das Floß viele Kadaver von Tieren auftauchen, die augenscheinlich aus dem überfluteten städtischen Zoologischen Park stammen und nach ihrer vergeblichen Flucht aus den Käfigen jämmerlich ertrunken sind. Erst nach der Einordnung dieser schrecklichen Bilder zeichnet sich eine Beruhigung der Situation ab. Zwischen den auf dem Floß dahintreibenden Personen, denen der Autor noch immer keine Namen gewidmet hat, häufen sich nun Wunschbilder, verdichten sich die ihre eigenen Erlebnisse. Ein allmählicher Gedankenaustausch zwischen dem Verkäufer und der Vertreterin zeichnet dann ab, als beide mit ihrem Floß jenseits der überfluteten Stadt ein Ufer erreichen, das im Fließtext als „Das Land“ genannt wird. Beim schwierigen Durchqueren des sumpfigen Geländes kommen sich die beiden auch körperlich näher. Ein direktes dialogisches Gespräch zwischen beiden entsteht, ohne dass der übermächtige auktorialer Erzähler sich einmischt. Beide bekennen sich zu ihren Schwächen, schwelgen in ihren Erinnerungen. Und wenn ihre sprachliche Artikulation versagt, dann geben sie sich sogar körperlichen Berührungen hin. Höchste Zeit also für den Topos V. Beide entdecken ein einsames Haus, in dem sich nun, wenn auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen, ein Leben zu zweit abzeichnen könnte. Doch der Erzähler dämpft die Erwartungen seiner wohl immer neugieriger werdenden Leser*innen. Das Haus wird „von Erinnerungen erfasst“, „schnell geschnittene Filmbilder“ fliegen vorbei, die Blenden öffnen und schließen sich. Visionen mischen sich mit eingebildeten Erinnerungen, unbekannte Gestalten und verstörte Menschen aus ihrer Jugendzeit purzeln durcheinander. Nur das Paar, dessen Namen wir auch im Finale nicht erfahren, liegt schlafend, als die Sonne aufgeht, in ihrem kaum von der Witterung geschützten Zimmer, während drei schwarze Katzen sie schnurrend umkreisen.
Die spannungsgeladene Novelle mit hoher Symbolkraft und Handlungsdichte, von einem disziplinierten auktorialen Erzähler und den verstörenden Erinnerungen zweier Protagonisten vorgetragen, fesselt aufgrund der fotografisch einprägsamen Wort- und Satzbilder. Ungeachtet des übermächtigen Erzählers, der unter der Regie des experimentalfreudigen Autors ein zwischen Fantasie und futuristischer Realität geblendetes Zeitdokument schafft, entsteht so eine packende traumbeladene Vision einer Gegenwart, die den Lesenden in hohem Maße beunruhigt. Zwischen einem städtischen überflutenden Raum und einer vermeintlichen ländlichen Idylle pendelnd fasziniert ihn das Vakuum der in der Novelle zelebrierten Beziehungen zwischen Menschen, die erst unter extremen klimatischen Bedingungen ihre einstigen Lebensbedingungen gleichsam „traumhaft“ wieder gewinnen. Ein hohes Lob für einen Autor, der mit außergewöhnlicher fiktionaler Strahlkraft den Lesenden „verzaubert“.