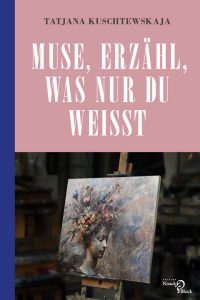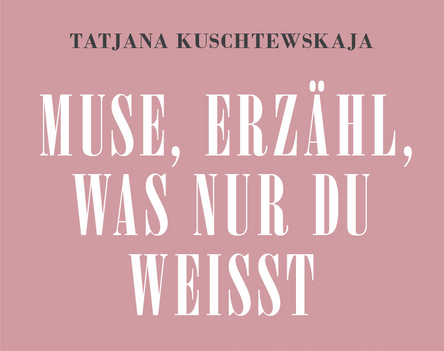
Tatjana Kuschtewskaja. Muse erzähl, was nur du weißt … Musen und Modelle im Leben und Werk berühmter Künstler. Aus dem Russischen von Steffi Memmert-Lunau. Berlin (Edition Noack&Block in der Frank & Timme GmbH) 2025. 201 S., ISBN 978-3-86813-184-0
Die doppelte Bezeichnung Muse in der Überschrift dieses eindrucksvoll gestalteten Buches ist mit dem Blick auf seine Gegenstände deutlich markiert: „die Helden und Heldinnen … waren Menschen mit der subtilsten spirituellen Verfassung, sie legten die schier fassbare Fähigkeit der Leidenschaft in ihre Kunst…“ (S.10). Diese Definition erläutert die Autorin – mit der russischen Kultur und Kunst bestens vertraut, mit dem Verweis auf die schwierige Zusammenarbeit von Musen und Künstlern.. Bei der Umsetzung dieser oft verdeckten Verflechtung von trügerischem Schein und illusionärer Hingabe schufen Künstler Millionen von Werken, jagten, so Tatjana unter Verweis auf den russischen renommierten Schriftsteller Robert Roshdestwenski, „Armeen / von Farbe in die Offensive“ (S.12)
Aufgrund dieser in einem Originalzitat zusammengefassten Aussage gewinnen Leserinnen und Leser eine nüchterne Distanz gegenüber den 11 besprochenen Kunstwerken und deren Entstehung. Von der Muse antiker Bildhauer am Beispiel von Praxiteles (330 bis 350 v.Chr.) mit dessen Muse Phryne (vgl. S.12ff.) bis zu dem Porträtmaler August Macke, mit porträtierter Frau im Bild mit der Bezeichnung „Frau des Künstlers mit Hut“ aus dem Jahr 1909 erhalten Leser einen Überblick über das schwierige Verhältnis zwischen den künstlerischen Gestaltern und deren Musen in der europäischen Kunstgeschichte. Die Aufzählung der in umfangreichen Artikeln (mit jeweiligen farbigen Abbildungen) ruft unter Kunsthistorikern* sicherlich sogleich wachsendes Interesse hervor: Raffael Santi, La Velata (Dame hinter dem Schleier), 1516; Jan Vermeer, Allegorie der Malkunst, 1673; John Everette Millais (Ophelia),1851-1852; Pierre August Renoir (Portrait Misia Sert), 1907; Gustav Klimt (Ein intimes Porträt),1902; Edward Munch (Madonna) 1894; Edward Munch (Eifersucht), 1895, Wassily Kandinsky ( Moskau I. Roter Platz),1916; Vera Jermolajewa, Drei Figuren(Golgatha) 1928, August Macke (Porträt der Frau des Künstlers mit Hut), 1909. Und Janina Kuschtewska (!!) (2012)
Es zeichnet die vorliegende Betrachtung über Musen und Modelle in der west- und mitteleuropäischen Kunstgeschichte durch die besondere Hingabe der Autorin gegenüber ihren Lieblingsobjekten aus. Dabei handelt es sich um Erlebnisse, die sie z.B. in Dresden nach dem Besuch des Zwingers und der dort zufällig ausgestellten SIxinischen Madonna mit einem Taxifahrer hatte. Er bescheinigt ihr, dass es schönere Madonnen gebe. Solche episodenhaften Einsprengsel in den Text verstärken unter kunstbeflissenen Lesern die Lust an einem Genre, das in der Regel von Kunstwissenschaftlern besetzt ist. Umso spannender sind deshalb Erzählpassagen über das Verhältnis zwischen Künstlern und Modellen. Wie z.B. jene Muse mit Buch und Fanfare des holländischen Malers Jan Vermeer aus dem Jahr 1673, die Tatjana Kuschtewskaja bei ihrem Besuch im Rijkmuseum zum Anlass nimmt, den Holländern zu bescheinigen, dass dessen Maler ihr Volk in einem alltäglichen Selbstporträt so abbilden wie Jan van Meer in seiner Darstellung einer scheinbar ganz alltäglichen Situation.
Ein weiteres Merkmal der vorliegenden kunstspezifischen Darlegung besteht in dessen konsequenter männlicher Darstellungsperspektive. Am Beispiel der jungen russischen Malerin und Kunstwissenschaftlerin Jelena Jermolajewa, die der politischen Verfolgung durch das bolschewistische sowjetische Regie ausgesetzt war, zeigt die Autorin, dass nach der Oktoberrevolution von 1917 auch Künstlerinnen in das Räderwerk des Geheimdienstes geraten waren. Diese Verfolgung politisch Andersdenkender durch den russischen Geheimdienst NKWD in den 1930 Jahren kommentiert die Autorin nun, soweit Quellen noch zur Verfügung stehen, in aller Deutlichkeit.
Auch das Ehepaar Nina und Wassilij Kandinsky war nach dem Ausbruch der Oktoberrevolution im Winter 1917 mit Drangsalierungen konfrontiert. Der Künstler war bereits während seines Aufenthalts in Deutschland weltberühmt aufgrund seiner Anerkennung als innovativer Maler, als Kunsttheoretiker und anerkannter Pionier der neuen Avantgarde. Es war eine Rolle, die er vor allem in Deutschland aufgrund seiner Bedeutung aufgrund von Kunstausstellungen hatte. Nina, die nun in Moskau seine Muse für zahlreiche neue Bilder war, wurde nun mit einem unliebsamen Rollentausch konfrontiert, den sie aufgrund ihrer unfreiwilligen Übernahme als Ehegattin annehmen musste.
Eine grundlegend andere Rolle spielten die Modelle, mit denen der norwegische Kunstmaler Edvard Munch (1893—1944) arbeitete. Die beiden abgebildeten Porträts (Madonna 1894/95); (Eifersucht 1895) vermögen nur einen oberflächlichen Eindruck von den komplizierten beruflichen Beziehungen des Malers zu seinen Musen zu vermitteln. Die in dem Titel „Das Lächeln einer Frau ist das Lächeln des Todes“ anklingende äußerst komplizierte Beziehung des Künstlers zu den dargestellten Frauen spiegelt sich auch in dem Lebenslauf von Munch wider. Tatjana Kuschtewskaja verfolgt in diesem Unterkapitel die Spur von Munch bis zu der norwegischen Künstler Dagny Juel, die Munch im Berliner Künstlermilieu in den 1880er Jahren kennenlernte und sogleich ein kompliziertes Verhältnis zu ihr begann. Ob es von Eifersucht geprägt war oder die krankhafte Beziehung des Malers zu Frauen prägte, wird bei Kuschtewskaja nur angedeutet. Dass Dagny nur wenige Wochen nach ihrem Aufenthalt unter mysteriösen Umständen aufgrund von Beziehungen zu polnischen Künstlern ermordet wurde, bleibt unerwähnt. Tatjana Kuschtewskaja schildert die Beziehungen des Malers zu Frauen, unter Berufung auf Rolf Stenerson -als undankbar und flüchtig, ein Urteil, was auf das sehr komplizierte Verhältnis des Künstlers zu seinen Musen verweist.
Auch in diesem Kapitel ihres Buches widmet sich die Autorin mit gründlichen Recherchen den schwierigen Beziehungen zwischen Künstler und Modellen, wobei sie, wie sie auch in ihrem Nachwort über die produktive Rolle von Co-Autorinnen und Künstlermodellen am Beispiel der Arbeit ihrer Tochter Janina, einer äußerst begabten Porträtmalerin, (vgl. S. 186ff.) berichtet. Diese Ausführungen verdeutlichen, dass die Autorin auch den Funktionswandel in den Beziehungen zwischen Maler/innen seit Beginn des 21. Jahrhunderts im Blick hat und ihn in ihre äußerst anregenden Ausführungen einbaut. Ein Buch also, dass nicht nur die tradierten Beziehungen zwischen Künstler und Musen bzw. Modellen lebendig und grundlegend beschreibt, sondern deren Funkionswandel einbezieht. Lebendig geschrieben, gründlich recherchiert, lesefreundlich verfasst, gehört „Muse,erzähl was nur du weisst“ in die Schatzkiste kunstbeflissener Leser/Innen, die viel Spaß bei dessen Lektüre haben werden.