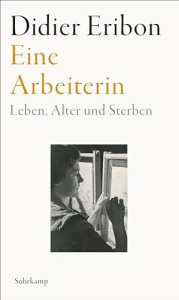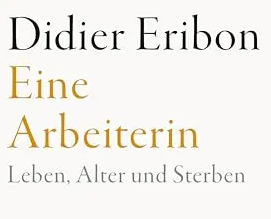
Didier Eribon, Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben, Aus dem Französischen von Sonja Finck. Berlin (Suhrkamp Verlag) 2024, Lizenzausgabe Büchergilde. 272 S.
Der aus vier Kapiteln bestehende sozialkritische Roman setzt sich aus der Perspektive des jüngsten Sohns einer ehemaligen Arbeiterfamilie mit einem brennend aktuellen Problem der französischen Sozialgeschichte auseinander.
Wie soll einer im hohen Alter erkrankten Frau – Mutter von vier Söhnen – der Aufenthalt in einem Pflegeheim unter humanen Bedingungen ermöglicht werden? Vor allem der jüngste Sohn aus dieser Familie, ein angesehener Wissenschaftler, bemüht sich immer wieder darum, dass seine Mutter in einem angesehenen Pflegeheim in der nordfranzösischen Provinz untergebracht wird. Doch diese wehrt sich vehement gegen allmögliche Versuche, „abgeschoben“ zu werden.
Sie flüchtet sich in Krankheiten und, beklagt sich über die Distanziertheit ihrer Söhne, die sie nicht in ihre Familien aufnehmen wollen. Nur ihr jüngster Sohn, als Homosexueller selbst unter der Distanziertheit der ihn umgebenden Gesellschaft leidend, kümmert sich aufopfernd um sie, ohne die Anerkennung seiner Mutter zu bekommen. Je länger diese Bemühungen um die soziale Integration der Mutter in einem Pflegeheim laufen, desto unhaltbarer wird die Situation, desto lauter beklagt sich die Mutter über die fehlende Liebe ihrer Söhne. Erst in den letzten Stunden ihres Lebens bekennt sie ihrem jüngsten Sohn, dass sie ihre Erfüllung gefunden habe. Sie habe sich zum ersten Mal im Leben in einen Mann verliebt und sei glücklich mit ihm.
Doch die individuelle „Lösung“ dieses Konflikts auf der familiären Ebene dieses offenbar akuten sozialen Konflikts regt den Autor in seiner Funktion als Sozialwissenschaftlers zur Suche nach literarischen Quellen? So verweist er im zweiten Kapitel seines Romans auf eine Reihe europäischer Sozialwissenschaftler und renommierte Romanautoren, die in ihren Werken nach „Lösungen“ eines schier „unlösbaren“ sozialen Problems suchen. Es handelt sich darum, dass in Altersheime und Pflegeheime abgeschobene ältere Menschen sowohl ihre Individualität, als auch ihre im Laufe ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten verlieren. Sie vertrauen nicht mehr ihrem Lebensmut und lassen sich in nicht lebenswerte Räume abschieben. So verweist der Autor in seiner Profession als Soziologe Eribon überraschender Weise auf ein Werk des renommierten tschechischen Schriftstellers Bohumil Hrabal, der in seinem Roman „Harlekins Million“ von der Scham spricht, den in ein Altersheim abgeschobenen alten Menschen empfinden. Es sei vor allem die fehlende Identität unter den Bewohnern, die unter ihrer Isoliertheit vom alltäglichen Alltag leiden würden. Eribon spricht vom „Verlust der räumlichen und zeitlichen Orientierung“ und verweist in diesem Kontext auf Samuel Becketts Bühnenwerk „Glückliche Tage“. Winnie, eine isolierte, betagte alte Frau sucht dort verzweifelt nach mehr „sinnhaften“ Strukturen in ihrem Leben. Diese hätten ihr in ihrer einstigen Lebenswelt eine gewisse Identität und Vertrautheit vermittelt. So wie der „chant des partisans“, den die Mutter in Eribons Roman plötzlich vor sich hin summt. Der Autor ist darüber sehr verwundert und findet sogleich eine Erklärung dafür. Ältere Menschen würden eine gleichsam innere Archäologie besitzen, mit der sie sich als Ersatz für ihre Vereinsamung in bestimmten Lebenssituationen trösten würden.
Mit dem Begriff der “Inneren Archäologie“ arbeitete, wie Eribon anmerkt, auch die bekannte deutsche Schriftstellerin Christa Wolf. In ihrer Erzählung „Leibhaftig“ (vgl. Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag) 2009. S. 119 verwendet sie diesen Begriff im Kontext eines medizinischen Notfalls. Eine nach einer komplizierten Operation ins Leben zurückkehrende ältere Frau gewinnt ihr Zeitgefühl wieder. Mit der Rückkehr in die Welt sei aber für sie nicht nur der Sinn für die Zeit, sondern sogar „die Anwesenheit in der Zeit“ möglich geworden.
In seinen weiteren Ausführungen beschreibt Eribon die Notlage seiner Mutter, die sich bei ihm ständig am Telefon und per Mailbox über ihre Situation im Pflegeheim beschwert. Auf Nachfrage wird er über den Mangel an Personal informiert, das die körperlich schwer leidende Frau nicht ausreichend betreuen kann. Doch es sei für ihn schwierig gewesen, die tatsächlichen Vorgänge in dem Pflegeheim einzuschätzen. Erst seine Auseinandersetzung mit anderen Berichten über die Situation in den Altersheimen und Pflegestätten der französischen Provinz offenbart nach Eribon eine Wahrheit: „Altersheime sind notorisch unterbesetzt und die Pflegekräfte müssen von einem Zimmer zum nächsten eilen, um die Bewohner zu versorgen.“ (S.96)
Die wechselseitigen Berichte über den allgemeinen Zustand in französischen Altersheimen und Pflegeheimen wie auch die Beschreibung der allgemeinen Notsituation älterer Menschen am Beispiel der Mutter des Autors rufen beim Leser ein wachsendes Mitgefühl hervor, das aufgrund der häufigen Verweise auf die thematische Verarbeitung dieses Problemfeldes beim Lesen gleichsam eine Pendelbewegung zwischen dem Mitleiden an der psychomentalen Notlage älterer Frauen und deren Schilderung in markanten Werken der zeitgenössischen Literatur hervorruft. Doch die Befragung bedeutender Philosophen und deren Suche nach Lösungsmodellen führt bei Eribon unter Verweis auf Jean Amerys Werk “Revolte und Resignation“ bei seinem finalen Versuch, die Welt alter Menschen zu erfassen , leider nur zu einer „Zwischenlösung“: „“Indem sie Konzepte entwickeln, in denen alte Menschen keinen Platz, keinen Raum haben … in denen alte Menschen keinen Raum, keinen Platz haben können, tragen die Philosophie und die politische Theorie zum Ausschluss des Alters und zur Ausgrenzung alter Menschen bei. Will man die Ausgeschlossenen zurück ins Feld des Denkens und des Handelns holen, steht jede Gesellschaftstheorie, die sich als kritisch und emanzipatorisch begreift, vor zwei grundsätzlichen, aufeinander aufbauenden Fragen: Können alte Menschen für sich selbst sprechen? Und wenn das nicht der Fall ist: Was kann oder muss man unternehmen, damit trotzdem gehört werden?“ (S. 255)
Eribon, Jahrgang 1953, Soziologe und Philosoph, hat in seiner Abhandlung über eine französische Arbeiterin – in der Person seiner Mutter -, ein „Klagelied“ über das Altwerden einer Arbeiterin geschrieben und zugleich den Niedergang einer französischen Arbeiterklasse analysiert, die für ihre in die Jahre gekommenen ehemaligen Gewerkschaftsmitglieder kein klassenbewusstes Engagement – außer reflektierten soziologischen Abhandlungen – zeigen. Sicherlich erfährt der Leser viel Wissenswertes über die Hintergründe des einsamen Sterbens in französischen Pflegeheimen, über die ursächlichen Hintergründe eines Sterbeprozess, in dem die Leidenden in ihrem Schmerz allein gelassen werden. Ein lesenswertes Buch, das Symptome eines schmerzhaften Prozesses beschreibt, in dem die Leidtragenden ihre Isoliertheit erst dann überwinden können, wenn sie ihr Bewusstsein von der „Schuld“ (wessen Schuld?) in breite Gesellschaftsschichten transportieren. Ist Rettung vor diesem lästigen Prozess des Älterwerdens in Sicht? Schon basteln Longevity-Forschende an einer „Revolution des Alterns“, wie Thomas Schulz in seinem „Projekt Lebensverlängerung“ (vgl. Spiegelverlag“ 2024), doch ist auf der Grundlage solcher Projekte eine wesentliche Lösung des Problems Älterwerden möglich?