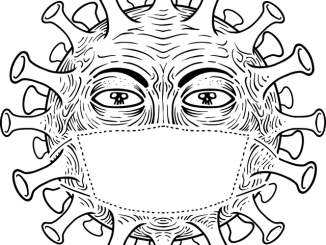Wenn man Behauptungen über langfristige Zusammenhänge anstellt, empfiehlt es sich, eine wissenschaftliche Studie zu erstellen, mit Quellenangaben und Statistiken. Eine andere Sache ist es, dieselben Dinge aus dem eigenen Erleben zu erzählen. Der Beweiswert einer derartigen Vorgehensweise ist sehr eingeschränkt, aber auch dieses Ergebnis kann für den Leser plausibel sein, also einen Erkenntniswert für sein Denken und vielleicht sogar für sein Tun haben. Für den Schreibenden, also für mich, ist es weniger aufwendig und geht schneller. Außerdem haben der Gedankengang oder die Erkenntnis ja noch die Chance, von einem, der mehr Zeit darauf verwenden möchte, also zum Beispiel von einem Wissenschaftler, aufgenommen und verarbeitet zu werden.
Das war die einleitende Begründung für die nachfolgende Art der Darstellung, die ich hier für ein ganz großes Thema gewählt habe, welches da letztlich lautet: Die Unterschiedlichkeit von US-amerikanischer Wirtschaftskultur und europäischer.
Den meisten geläufig ist die üblichen Zusammenfassung: Die Amerikaner sind einfach anders, denken und fühlen anders. Über das, was dieses „anders“ ausmacht, kann man sich auf viele Details verständigen, auf Freiheitsdrang und Freiheitsliebe, auf Unabhängigkeit und Ablehnen von Abhängigkeit, auf rüde Geschäftstüchtigkeit und auf äußerliche Freundlichkeit, die damit zusammen hängt. Vor etwa zwanzig Jahren beschäftigte sich der Harvard-Wissenschaftler Peter Hall mit der Frage, in wieweit sich Europäer und Amerikaner bei der Beantragung von Patenten unterscheiden. Dass Europäer eher auf länger dauernde Entwicklungen und langfristige Erfolge gesetzt haben, während jenseits des Atlantiks eher kurzfristige Erfolge gesucht wurden, verwundert hierzulande niemanden. Und – um hinsichtlich der Wirtschaftskultur zum aktuellen Thema „Corona“ den Bezug herzustellen – niemand ist darüber verwundert, dass die Infektionswelle in den USA binnen wenigen Wochen 30 Millionen Arbeitslose produzierte, während sie hierzulande mit langfristiger Kurzarbeit für 10 Millionen Arbeitnehmer abgefangen wurde.
Mindere Lebensmittelqualität fördert Corona
Natürlich ist Corona hier das Thema. Auch hier gibt und gab es einen eklatanten Unterschied zwischen den USA und Europa, weil die Infektionsraten wohl doch signifikant höher waren/sind, weshalb ich die These aufstelle, dass hieran die Qualität der US-amerikanischen Lebensmittel maßgeblichen Anteil haben (abgesehen von den prekären Lebensverhältnissen größerer Bevölkerungsteile). Die Dominanz von Fastfood ist bekannt und wohl auch Ursache für die überbordende Fettleibigkeit der dortigen Bevölkerung. Man spricht von 50 Prozent der Bevölkerung, die übergewichtig sind.
Dass darin ein signifikanter Faktor zu suchen ist, ist bekannt. Aber das ist ja nur ein Faktor. Eine weitere wesentliche Ursache dürfte ganz generell in der Qualität der dortigen Lebensmittel zu suchen sein, bei der ein Vergleich zu europäischen geradezu unbeschreiblich schlecht ist, sieht man von ein paar exklusiven und teuren Restaurants und sonstigen exklusiven Quellen ab. Zur „Unbeschreiblichkeit“ habe ich zwei Beispiele aus eigenem Erleben. Das erste Beispiel ist ein Photo, das vor zehn Jahren in Berlin auf einem Kongress der Milchbauern gezeigt wurde. Auf dem Bild fuhr ein Touristenbus mitten durch einen US-Stall mit Milchkühen, die links und rechts davon in Reh und Glied standen. Das Ende der Reihe war nicht mehr erkennbar. Die Erläuterung des Bildes enthielt die Information, dass es auf diesem Hof 37.000 Milchkühe gebe, was ihn zur Touristenattraktion mache. Angesichts dieser Zahl fragt sich allerdings, ob auf diesem „Hof“ noch Milch produziert wird, oder nur so etwas ähnliches.
Ich habe im Laufe der Jahre auch sonst noch ein paar Informationen über Milch gesammelt. Sie beginnen bei der Erzählung eines Werbekaufmannes, der meinte, man habe in seiner Jugend zuhause immer so 7 bis 8 Kühe im Stall gehabt und wenn er in der Küche Milch trank, dann konnte er sagen, von welcher Kuh sie stammte. An eine zweite wichtige Information gelangte ich, als ich vor ein paar Jahren auf einer Almhütte einen Milchbauern besuchte – in seinem Stall standen 19 Kühe -, der mich über Milchqualität aufklärte. Für die Qualität der Milch und danach der Butter und der Käsesorten, die daraus gewonnen würden, sei vor allem wichtig, dass die Kühe auf der Weide auch viel Blumen und Kräuter mitfressen. Und genau die bekommen sie oben auf der Alm reichlich.
Auch bei uns in Deutschland sind die Kleinbauern ausgestorben, weil das Überleben eines Milchbauernhofes bei den aktuell gesunkenen Preisen mindestens 100 Milchkühe verlangt. So viele Kühe kommen noch alle hin und wieder auf die Weide. Schwieriger wird es mit den heute immer mehr üblichen größeren Höfen mit 400 Milchkühen oder mehr. Deren Futter besteht dort überwiegend aus sogenannter „Silage“, also Futter, das in die Ställe mit der Traktorschaufel transportiert und dort in die Futtertröge verteilt wird. Von Blumen und Kräutern ist nicht mehr die Rede, eher von Zusätzen an Antibiotika oder Wachstumsmitteln, um die Milchleistung zu fördern. Was herauskommt, sieht aus wie Milch, hat aber mit echter Milchqualität kaum mehr etwas zu tun, abgesehen davon, dass die Kühe gar keine Lust mehr auf Bewegung auf Weiden haben, weil sie dort nicht mehr satt werden, was auch die Weiden begrüßen, weil sie die bewegungslos-überschweren Kühe gar nicht mehr tragen können. Sie sinken zu tief ein und machen die Wiesen kaputt. Um auf den amerikanischen Hof zurück zu kommen: Was da auf dem Hof mit 37.000 Kühen produziert wird, mag man sich so gar nicht mehr vorstellen. Gesunde Milch ist es jedenfalls nicht.
Mindere Qualität, nicht nur bei der Milch
Das ist jetzt nur die Milch, und natürlich sieht es in den anderen Bereichen der industriellen Erzeugung von Lebensmitteln nicht anders aus. Als kursorische Erläuterung aus eigenem Erleben mag das zweite Beispiel ausreichen: Ein US-amerikanischer Sportsfreund, Peter, Angestellter eines US-Automobilzulieferers und begeisterter Anhänger der Qualität deutscher Lebensmittel, erzählte mir eines Tages von seiner Frau, die, wie in jedem Sommer, mit den Kindern in ihrem Haus in Philadelphia Urlaub machte. Am Abend vorher hatten sie zusammen telefoniert. Ihr Bericht enthielt den Satz: „Peter, ich war heute einkaufen, ich habe nichts gefunden, was man essen kann!“ Wen wundert es dann noch, dass US-Amerikaner keine Abwehrkräfte haben oder durch zu viele Antibiotika in ihren Lebensmitteln anfällig und abwehrgeschwächt sind.
Der Zusammenhang zwischen Corona-Auswirkungen und Lebensmittelqualität scheint offensichtlich zu sein und These eins zu bestätigen. Nur, jetzt stellt sich die Frage, was ist für das System der industriellen Landwirtschaft bzw. massenhaften Lebensmittelproduktion überhaupt verantwortlich? Die zweite These dazu lautet: Der dominante Faktor für die Entwicklung der Produktionsstandorte zur Übergröße und zur minderen Qualität ihrer Produkte ist der Sherman Antitrust Act von 1891, oder zu Deutsch: Das Kartellverbot.
Die Begründung hierfür findet man auf dieser Seite des Atlantiks, bei der Erklärung für das Phänomen „Made in Germany“, also des Qualitätssiegels der deutschen Wirtschaft. Dessen Ursprung liegt im Zunftwesen der Städte des Mittelalters, die für die Entwicklung der Qualität ihrer Produkte berühmt waren. Beispiel: Nürnberger Loden. Das System dahinter waren Preisabsprachen beziehungsweise Preisfestsetzungen im mittelalterlichen Stadtrat, die den Preiswettbewerb verhinderten und dadurch den Qualitätswettbewerb förderten. Die Begründung ist einfach: Wenn handwerkliche Produkte überall dasselbe kosten, geht man dorthin, wo einem für denselben Preis „am meisten“ geliefert wird, aber natürlich nicht quantitativ mehr, weil das ja eine Preisunterbietung wäre, sondern nur qualitativ mehr. Folge war nicht nur eine hohe Produktqualität, sondern gleichzeitig allgemeiner Wohlstand, weil Preisabsprachen bei vielen Produkten auch insgesamt ein hohes Einkommensniveau sicherten. Das war das Rezept zu allgemeinem Wohlstand, wie ihn die mittelalterlichen Städte heute noch ausstrahlen.
Dieses System der gemeinschaftlich vereinbarten Preise, Konditionen und Regionen stülpten die Kartellbrüder der nichtschlagenden Studentenverbindungen im Jahr der Gründerkrise, 1873, der jungen Industriegesellschaft über, mit der Folge, dass es im Laufe von circa dreißig Jahren zu eben diesem Gütesiegel „Made in Germany“ führte.
Das fatale Verbot kaufmännischer Solidarität
Die US gingen im Jahr 1891 mit dem Sherman Antitrust Act genau den entgegengesetzten Weg und verboten jegliche Absprachen. Zielobjekt war unter anderem der legendäre David Rockefeller und sein Montagsclub, im Rahmen dessen der Öl Mogul seinerzeit dafür sorgte, dass der Ölpreis in seinem Sinne nach oben reguliert wurde. Innere Motivation war ersichtlich der Neid, den der Reichtum Einzelner hervorgerufen hatte. Es ist in den USA noch heute bei Strafe (Gefängnisstrafe!) verboten, mit dem Wettbewerber zu kooperieren und sich mit ihm abzusprechen. Die Folge ist zwangsläufig ein kontinuierlich scharfer Preiswettbewerb, also ein Verfall der Preise, aber eben nicht nur bei Massengütern wie Öl, sondern auch bei Industriegütern, wie Automobilen – und mit ihm ein Verfall der Qualitäten.
Die Unterschiedlichkeit der Ergebnisse beider Systeme lassen sich beschreiben: Bei der Fusion der beiden Autokonzerne Daimler und Chrysler vor etwa zwanzig Jahren berührten sich die Wirtschaftssysteme hautnah. Schön ist die Geschichte, als Daimler-Ingenieure seinerzeit in Detroit einen Chrysler-PKW zerlegen ließen und beim Anblick der einzelnen Komponenten sagten, „und daraus kann man ein Auto bauen?“ Kürzlich las ich den Autotest über einen heißen Chrysler-Sportwagen. Besonders gelobt wurde das Fahrwerk, weil es besser ist als der übliche Standard in US-Fahrzeugen. Die Begründung war, dass das Auto vom Erbe eines Mercedes-E-Klasse-Fahrwerks profitierte.
Aber es sind nicht nur die Lebensmittel, die Autos, die Textilien, die Häuser, die Möbel, das gesamte Handwerk, das eben wegen des Verbots nützlicher Solidargemeinschaften und des daraus resultierenden Preisdrucks keine Qualität liefern kann. Das vom Gesetz verfolgte Ziel ist stets der niedrige Preis und die dadurch permanent erzwungene Effizienz der Produktion, die zu immer größeren Produktionseinheiten und dem entsprechenden Qualitätsverfall führt. „Its enough for the customer,“ hat sich deshalb in den USA als kaufmännisches Regelverhalten entwickelt.
Man kann sagen, die Fehlentscheidung des Jahres 1891 ist in ihren Langzeitwirkungen über 130 Jahre fatal. Das Verbot von Solidargemeinschaften mit ihren Auswirkungen auf die Produktqualitäten, vor allem auch bei Lebensmitteln, bringt in Zeiten von Corona in den USA die gesamte staatliche Gemeinschaft in Not. Wenn Donald Trump das wüsste, würde er sicherlich richtig reagieren und den Sherman Antitrust Act aussetzen.