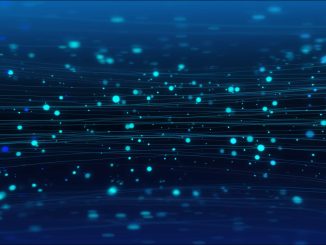Andreas Biefang, Dominik Geppert, Marie-Luise Recker, Andreas Wirsching (Hrsg.): Parlamentarismus in Deutschland von 1815 bis zur Gegenwart. Historische Perspektiven auf die repräsentative Demokratie. Eine Publikation der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Düsseldorf: Droste Verlag 2022, 476 Seiten, Paperback, 49,90 Euro
Die parlamentarische Demokratie hat bei den Bürgern an Rückhalt verloren. So wird man wohl die Zahlen aus dem jüngsten Deutschland-Monitor (DM) des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, zum Tag der deutschen Einheit 2022 interpretieren dürfen. Nur noch 59 Prozent der Westdeutschen und 39 Prozent der Ostdeutschen sind „mit der Demokratie zufrieden, so wie sie in Deutschland funktioniert“, lediglich 42 Prozent „aller Befragten sind mit der politischen Situation in Deutschland alles in allem zufrieden“ (DM2022, 92). Häufig wird dies angesichts der vielfältigen und verflochtenen Krisen der Gegenwart auf ein Lieferproblem der Politik zurückgeführt. Andere suchen die Ursachen eher bei einer mehrheitlich vermeintlich verirrten politisch-medialen Klasse, die mit „woker“ Politik, dem Leitwert „Diversity“, durch „cancel culture“ und anderem mehr an den Interessen und Überzeugungen breiter Mehrheiten im Volk vorbei regiert. Die derart Gescholtenen werfen im Gegenzug dem vornehmlich rechts verorteten Populismus vor, das Vertrauen in die repräsentative Demokratie auszuhöhlen, indem sie sich als Fürsprecher eines vermeintlichen Volkswillens gegen das politische System inszenieren.
Für jede dieser Perspektiven lassen sich Gründe finden. So viel sie auch trennen mag, verbindet sie eines: Sie bleiben stark der Gegenwart verhaftet, von einem mehr oder minder historisch gut informierten „Nie wieder!“ einmal abgesehen. Geschichtliche Einordnung kann mancherlei leisten: wiederkehrende Muster und das wirklich Neue der aktuellen Lage unterscheiden helfen; vor simplen Analogieschlüssen bewahren; sich die Faktoren zu vergegenwärtigen, die parlamentarisch-demokratische Verfahren begünstigen oder zu ihrem Scheitern beigetragen haben; über die Pfadabhängigkeit wie den Variantenreichtum möglicher Entwicklungen nachzudenken.
Gliederung und Inhalt
Zu all dem vermag ein Sammelband beizutragen, den die „Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien“ anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens 2022 herausgegeben hat. Der selbst gesteckte Anspruch ist hoch. Die Herausgeber kündigen ein „Handbuch aus historischer Perspektive“ für einen breiten Leserkreis zu gut 200 Jahren deutscher Parlamentarismusgeschichte von 1815 bis zur Gegenwart an. Zudem sollen die Argumente gebündelt werden, „welche die Geschichtswissenschaft zur gegenwärtigen Debatte über den Zustand der parlamentarischen Demokratie beizutragen hat“. Zu dem Modell der Demokratie also, in dem die Regierung vom Parlament gewählt wird und sich im Normalfall auf eine parlamentarische Mehrheit stützen kann.
In der Tat entfalten die Autoren ein breites parlaments- und demokratiegeschichtliches Panorama. Die ersten acht Beiträge sind gut gewählten thematischen Längsschnitten durch die Epochen und politischen Systeme gewidmet. Dabei geht es um Grundfragen wie das spannungsreiche Verhältnis zwischen Repräsentation und Parlamentarismus auf der einen und der Demokratie im Sinne einer gleichsam ungefilterten Volksherrschaft auf der anderen Seite (Andreas Biefang); Formen der „Selbstorganisation der Gesellschaft“ in Kommunen, Vereinen, Versammlungen, Parteien, Kammern, Interessenverbänden, Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und ihre Bedeutung für die Parlamente (Andreas Schulz); die Rolle der Parlamente unterschiedlicher Ebenen in den staatenbündischen und bundesstaatlichen Ordnungen (Siegfried Weichlein); Wahlkämfe und Wahlen (Thomas Mergel); Parlamentarismuskritik, Antiparlamentarismus und alternative Repräsentationsmodelle (Hans-Christof Kraus); die politische Teilhabe von Frauen (Barbara von Hindenburg und Bettina Tüffers); Auswahl, Abhängigkeiten und Arbeitsweisen der Abgeordneten (Marie-Luise Recker) und schließlich das Verhältnis zwischen Parlamenten, Medien und Öffentlichkeit (Frank Bösch).
Nicht weiter verwunderlich, war und ist von all diesen Randbedingungen abhängig, was Parlamente und Parlamentarismus im Laufe der zwei Jahrhunderte jeweils sein sollten, was sie durch unvorhergesehene Entwicklungen tatsächlich wurden und bewirken konnten, wodurch sie als Volksvertretungen ihren Einfluss mehrten oder eben auch scheiterten. Gelegenheit, dies durch einen genaueren Blick auf die jeweiligen Epochen zu vertiefen, bieten fünf chronologische Beiträge: zum Übergang vom Ständestaat zum Frühkonstitutionalismus 1800 bis 1847 (Hans-Werner Hahn), zu den nationalen Parlamenten im föderalen System von der Nationalversammlung in der Paulskirche bis zum Reichstag des Kaiserreichs (Andreas Fahrmeir); zum Reichstag der Weimarer Republik (Wolfram Pyta) sowie dem Bundestag seit 1949 (Hélène Miard-Delacroix). Ein Beitrag ist der einzigen demokratisch gewählten, 10. Volksammer der DDR gewidmet (Bettina Tüffers). Der Band schließt im dritten Teil mit drei Beiträgen zu „Perspektiven auf den Parlamentarismus“. In der politikwissenschaftlichen Perspektive gerät noch einmal die große Vielfalt von „Vertretungskörperschaften“ in den Blick (Werner J. Patzelt), und die Konsequenzen der europäischen Integration werden erörtert (Frank Schorkopf). Im letzten Beitrag überprüfen die Verfasser (Dominik Geppert/Andreas Wirsching) die These von der „Krise der Repräsentation“, die mehrfach im Sammelband aufgegriffen wird.
Es ist nicht möglich, die 16 höchst informativen Beiträge jeweils gesondert zu würdigen. Stattdessen sei anhand einiger gegenwärtiger Probleme der parlamentarischen beziehungsweise repräsentativen Demokratie zunächst dargelegt, was die historische Perspektive zur Einordnung der aktuellen Lage leisten kann.
Wahlen als Ursprung demokratischer Legitimation
Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und Bundestag in den Berliner Wahlbezirken 2021 wie auch die Auseinandersetzung um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in den USA 2020 haben das Vertrauen erschüttert, dass Wahlergebnisse in den Demokratien des Westens in geordneten Verfahren zustande kommen und akzeptiert werden. Das ist besorgniserregend, denn Ausgangspunkt demokratischer Legitimation sind Wahlen. Der Weg dahin war lang und keineswegs geradlinig.
Das Wahlverfahren entwickelte sich in Abhängigkeit von der Zahl der Wahlberechtigten, die anfangs sehr gering war. Lange Zeit waren offene Wahlen die Regel. Das hatte zunächst nur den Zweck, den korrekten Verlauf der Wahlen zu gewährleisten. Mit der wachsenden Zahl der Wahlberechtigten wurde daraus allerdings ein Mittel der sozialen Kontrolle, zumal der Arbeiterschaft. Mit deren Diskriminierung brach das für seine Zeit europaweit unvergleichlich fortschrittliche allgemeine, gleiche und grundsätzlich geheime Männerwahlrecht des Kaiserreichs von 1867/71. Das Reichstagswahlrecht verlieh „dem neugegründeten Nationalstaat überhaupt Stabilität und Glaubwürdigkeit“ (Biefang, 36). Doch erst 1903 wurden Wahlkabinen zur Pflicht (Mergel, 127).
Ein unverlierbarer Gewinn war die geheime Wahl keineswegs. Das Beispiel der DDR zeigt es. War der national integrative Effekt im Kaiserreich mit dem Zweck verbunden, die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse zu bestimmen, hatten Wahlen in der DDR gerade diese Funktion nicht, sondern die, eine „performative Einheit zu dokumentieren“. Wer geheim in der Wahlkabine wählte, machte sich verdächtig (Mergel, 121). Kritik am Wahlakt, den gefälschten Ergebnissen der Kommunalwahlen ohne Auswahl im Mai 1989 wurde zu einem der Ausgangspunkte der Friedlichen Revolution 1989/90. Vor diesem Hintergrund erfordert die Ausgestaltung der Wahlen und des Wahlakts gesonderte Aufmerksamkeit. Die „Relativierung von Wahltag und Wahlort als Schauplätzen der Demokratie“ wird als problematisch bewertet (Mergel, 129). In die Kritik geraten die Briefwahl und elektronische Stimmabgaben, aber auch Ergebnisprognosen auf der Basis von Nachwahlbefragungen (Biefang, 48; Mergel, 129). Letzteres war bei den Berliner Wahlen 2021 eines der größten Probleme. Wie frei und geheim eine Briefwahl ist, kann letztlich nicht überprüft werden.
Mehrheitswahl oder Verhältniswahl
Nicht allein angesichts der in Deutschland heute weitgehend üblichen Sechsparteienparlamente taucht gelegentlich der Gedanke auf, zu einem Mehrheitswahlrecht zurückzukehren. Ein Wahlrecht also, bei dem nur Wahlkreiskandidaten gewählt, aber keine Listen mehr aufgestellt werden. Das Wahlrecht hat auf das Verhältnis zwischen Bürgern, Parteien und Parlament großen Einfluss. Im Kaiserreich wurden die Reichstagsabgeordneten in 397 Einmannwahlkreisen gewählt. Der Einfluss der lokalen Kräfte war verhältnismäßig groß, die Verbindung zwischen Wählern und Gewähltem vergleichsweise eng. Doch während in den Wahlkreisen heute gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt (§ 5 BWahlG), waren bei den Wahlen zum Reichstag Stichwahlen vorgesehen. Dies begünstigte „tendenziell Kandidaten der Mitte, konnten sie doch im Falle einer Stichwahl am ehesten ein Maximum an Wählerstimmen auf sich ziehen“ (Recker, 216). Eine große Vielzahl an Fraktionen und Abgeordneten verhinderte dies dennoch nicht. Dem 1912 gewählten Reichstag gehörten Abgeordnete von rund einem Dutzend Parteien oder nationalen Minderheiten an. Wobei lediglich fünf mehr als 5 Prozent auf sich vereinigten. Darauf gehen die Autoren des Bandes allerdings nicht ein.
Der Übergang zum Verhältniswahlrecht der Weimarer Republik änderte das Bild. Das Land war nun in 35 Reichstagswahlkreise aufgeteilt, in denen über Listen abgestimmt wurde. Das stärkte den Einfluss der Parteien, reduzierte die Rolle der Persönlichkeitswahl und ließ den Anteil der Partei- und Verbandsfunktionäre an den Abgeordneten wachsen (Biefang, 43f; Recker 216f). Die ausgeprägte Abhängigkeit der Reichstagsfraktionen von den Parteien und den sie tragenden Milieus war eine der Ursachen für die mangelnde Kompromissfähigkeit im Reichstag selbst (Pyta, 313ff, 324). Das personalisierte Verhältniswahlrecht für den Bundestag ist eine der Antworten auf die Krisen der Weimarer Republik. Es zollt aber auch der Einsicht Respekt, dass „die Repräsentation einer so komplexen Gesellschaft nicht mehr durch deren lokale Dimension geleistet werden“ konnte (Mergel, 119). Ein ungelöstes Problem ist die durch Überhang- und Ausgleichsmandate zunehmende Abgeordnetenzahl.
Repräsentation
Abgeordnete gelten nach dem Grundgesetz und den Verfassungen der Länder als Vertreter des ganzen Volkes, die an Aufträge und Weisungen nicht gebunden sind, und in allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen gewählt werden (Art. 38 GG). Auch die Frage, wer wie die Repräsentanten des Volkes wählt und ob sie in ihrer Gesamtheit als Repräsentanten des Staatsvolkes betrachtet werden, ist beständig im Fluss. Die Debatten in manchen Bundesländern, das Wahlrecht für 16-Jährige einzuführen, Wahlrechte für Nicht-Staatsangehörige oder die Diskussionen über die vom Bundesverfassungsgericht einstweilen verworfene Pflicht, Wahllisten abwechselnd mit Männern und Frauen zu besetzen (Parität), zeigen es. Die Frage, wie jemand ins Parlament kommt und wen er dort mit dem freien Mandat vertritt, ist dabei zu unterscheiden. Da die Prinzipien der Repräsentation und das freie Mandat immer in einem Spannungsverhältnis zu Ansprüchen unmittelbarer Demokratie stehen, ist politisch entscheidend, dass – in Anlehnung an Hans Kelsen – die „Repräsentationsfiktion“, die Glaubwürdigkeit des Parlaments beständig aufrechterhalten werden kann (Biefang, 19).
Am Beginn des modernen Verfassungsstaats steht „die Abkehr von der `Identitätsrepräsentation´ der frühneuzeitlichen Ständeversammlung zu `abstrakten Repräsentation´, bei der die gewählten Abgeordneten mit ungebundenem Mandat jeweils das ganze `Volk´ vertraten“ (Herausgeber, 15). Bis dahin repräsentierten Landstände Territorien oder ständische Korporationen (Patzelt, 380). Das moderne Repräsentationsverständnis führte mitnichten dazu, dass jeder oder gar der größere Teil der Bürger wählen oder gar gewählt werden konnte. Bereits das erst 1919 eingeführte Frauenwahlrecht zeugt davon, dass bis dahin die Hälfte des Volkes von vornherein ausgeschlossen war (v. Hindenburg/Tüffers).
Zunächst entwickelte sich das Verständnis, tatsächlich das Volk zu repräsentieren. Das Wahlrecht und die Wählbarkeit waren jedoch an zahlreiche, höchst unterschiedliche Kriterien gebunden, die wirtschaftliche Solidität und soziale Zuverlässigkeit gewährleisten sollten (Mergel, 112ff). Das erwähnte Reichstagswahlrecht brach damit, das Wahlrecht der deutschen Länder jedoch keineswegs. Häufig blieb es bei indirekten Wahlen über Wahlmänner, unterschiedlichem Stimmgewicht nach Wählerklassen oder es wurden berufsständische, korporative Elemente in das Landeswahlrecht einbezogen. Die korporative Komponente lässt sich bis in den erst 1999 abgeschafften Bayerischen Senat als zweiter Parlamentskammer verfolgen (Patzelt, 380).
Aufschlussreich ist, dass die Parlamentarismuskritik häufig an den Möglichkeiten und Grenzen der Repräsentation ansetzt, seit es den modernen Verfassungsstaat gibt. Von links wurden Parlamente und parlamentarische Repräsentation, sehr stark vereinfacht, in der Regel eher kritisiert, weil sie mit ihrer Filter- und Ausgleichsfunktion als Hemmnis für die unmittelbare Entfaltung von Demokratie und Volkssouveränität verstanden wurden. Rätemodelle sind hier nur eine Alternative. Kritik von rechts hob eher auf die starke Rolle der Parteien ab, zumal in der parlamentarischen Demokratie, und auf das, so diese Sicht, wirklichkeitsfremde Prinzip der abstrakten Repräsentation (Kraus).
Parlament und Gewaltenteilung
Wen das Parlament wie repräsentiert und das, was es rechtlich und tatsächlich kann oder vermag, sind zweierlei paar Schuh. Doch wenn Populisten gegen „die da Oben“ zu Felde ziehen, dürfen sich der Bundestag und die Landtage mit gemeint fühlen. Das kommt nicht von ungefähr. Hilfreich ist die Unterscheidung zwischen dem „alten Dualismus“ der konstitutionellen Monarchie einerseits und dem „neuen Dualismus“ der parlamentarischen Demokratie andererseits (Patzelt, 389ff). Im ersten Fall, jenem der konstitutionellen Monarchie, stand das Parlament als Vertretung der Gesellschaft dem Monarchen und der von ihm abhängigen Regierung im Grunde gegenüber. Jedenfalls sofern die Bürger die Parlamente als einigermaßen repräsentativ akzeptierten. Das änderte sich 1918/19. Mit der „Parlamentarisierung“, also der Abhängigkeit der Regierung vom Parlament, „die eine Teilidentität von Regierung und Legislative mit sich brachte“, wurde der Reichstag von 1919 an zunehmend als „Teil der `Obrigkeit´“ wahrgenommen (Biefang, 42).
Das erscheint aus heutiger Sicht unfair, da das Prinzip der parlamentarischen Demokratie in der Weimarer Reichsverfassung gar nicht konsequent durchgeführt war. Nicht allein der Reichstag, auch der Reichspräsident war direkt gewählt, er berief die Regierung, konnte übergangsweise mit Notverordnungen den Reichstag als Gesetzgeber ersetzen und ihn überdies auflösen. Ein handlungsfähiger Reichstag konnte diese Kompetenzen wirksam kontern. Er musste aber nicht. Denn die Regeln erlaubte es den Fraktionen, sich nicht einigen und die politischen Kosten parlamentarischer Kompromissen nicht tragen zu müssen (Patzelt, 390). Zumal der Reichspräsident die Parteien durch die Auflösung des Reichstags jederzeit in den Wahlkampf stürzen konnte. „Diese Verfasstheit leistete jenen Kräften Vorschub, die bei jeder sich anbahnenden Regierungskrise den Ausstieg aus der Regierungsverantwortung anstrebten“ (Pyta, 314). Das schwächte das Parlament und sein Ansehen und gab anderen Akteuren Raum. „Am Ende stand die plebiszitär abgestützte Führerdiktatur“ (Biefang, 45), die im Übrigen auf eine „pseudo-parlamentarische Legitimation“ durch den mehrmals nach Einheitslisten gewählten Reichstag Wert legte (Kraus, 154). Das Grundgesetz war der konsequent parlamentarisch-demokratische Gegenentwurf zur Weimarer Reichsverfassung.
Die Weimarer Verfassungskonstruktion wurzelte in der aus dem Kaiserreich überkommenen Furcht der Liberalen vor dem „Parlamentsabsolutismus“, der durch die starke Stellung des Präsidenten und durch Volksbegehren und Volksentscheid als direktdemokratische Elemente vermieden werden sollte. Völlig aus dem Nichts kam diese im Ergebnis fatale Furcht nicht. In der konstitutionellen Monarchie und im begrenzten Wahlrecht hatten große Teile des Liberalismus stets auch eine Schranke gegen Ansprüche der sozialistischen Arbeiterschaft gesehen. Deren Repräsentanten wiederum sahen in der Gewaltenteilung bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert ein Hindernis für ihre Ambitionen. Folgereich vereinten sie nach 1945 in der SBZ/DDR alle Gewalt soweit möglich in den Landtagen und dann in der Volkskammer. Die fungierte allerdings nur noch als „Transmissionsriemen“ der Politik der SED (Tüffers, 359f).
Föderale Ordnung und europäische Integration
1952 schaffte die SED in der DDR Länder und Landtage ab. Es ist nicht überraschend, dass die Einheitssozialisten wie zuvor die Nationalsozialisten nicht allein den Parlamentarismus zerstörten, sondern den Föderalismus gleich mit. Denn auch regionale Gestaltungsmacht ist Teil einer vitalen demokratischen Ordnung, die nicht mit dem Durchregieren der jeweiligen Mehrheit verwechselt werden darf. Ihre enorme Leistungsfähigkeit zeigte die föderale Ordnung bei der Integration der neuen Länder nach 1989/90. In der Kritik stand und steht sie dennoch regelmäßig.
Das Kaiserreich war wie zuvor schon der Deutsche Bund ein Bund seiner Fürsten. Die parlamentarischen Regierungen haben das Erbe angetreten und vertreten ihre Länder seit 1949 im Bundesrat. Oft genug gaben sie Kompetenzen gegen Beteiligung im Bundesrat ab. Das war so ursprünglich nicht gedacht und hatte Konsequenzen: „Der Föderalismus war keine Ordnung von unterschiedlichen Ländern mehr, sondern ein Strukturelement der Gewaltenteilung“ (Weichlein, 99). Verlierer in diesem deutschen Exekutivföderalismus sind die Landesparlamente, denn nicht sie, sondern die Landesregierungen wirken über den Bundesrat an der Gesetzgebung. Der eigentliche Gewinner sind die Parteien, die Bundestag, Bundesrat und Staatskanzleien verklammern. Am Ende dominiert das Parteiinteresse die Interessen der Länder. Gut sichtbar wird dies in den Bundesratsklauseln in den Koalitionsverträgen auf Landesebene. Nicht die Landesparlamente entscheiden, sondern die Koalitionspartner. Das notwendige Aushandlungssystem fördert die von Fritz W. Scharpf schon 1985 kritisierte „Politikverflechtung“ und eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners (Weichlein, 101).
Im Zuge der Wiedervereinigung und in den Folgejahren haben sich Föderalismus-Kommissionen um eine Entflechtung bemüht, und Länder und Landesparlamente haben über Art. 23 GG in Europaangelegenheiten substantielle Mitspracherechte erhalten. Dies löst allerdings das Grundproblem nicht: den permanenten Abstimmungsbedarf zu immer komplexeren Herausforderungen: „An die Stelle des Föderalismus und Parlamentarismus scheint etwas Dritte getreten zu sein, das für eine neue Art governance steht, nämlich permanent arbeitende Politikernetzwerke mit Abgeordneten, Vertretern der Regierung und der Länder, Sachverständigen und Interessenvertretern. […] Dieser grand coalition state arbeitet seit den 1970er Jahren mit knappen demokratischen Legitimationsressourcen“ (Weichlein, 104).
In der Rückschau erstaunlich ist, dass der Abfluss nationalstaatlicher Kompetenzen im Zuge der europäischen Integration zunächst nicht als demokratisches Problem erkannt und dann durch den Bundestag lange ignoriert worden ist. Die im Europäischen Rat versammelten Regierungen konnten damit leben, die Parlamente eigentlich nicht; die Landesparlamente noch weniger als der Bundestag. Bis zum Ende der 1980er Jahre erwartete man, dass ein erstmals 1979 überhaupt gewähltes, beständig um Kompetenzen ringendes Europäisches Parlament demokratisch kontrollieren sollte, was die nationalen Parlamente nicht mehr kontrollieren konnten. Den Hintergrund bildete das Zielbild eines europäischen Bundesstaates. Sowohl diese „Kompensationslösungen“ wie das Ziel verloren um 1990 an Plausibilität und Rückhalt. Subsidiarität und die Einbeziehung der nationalen und regionalen Parlamente wurden zu Leitgedanken, die im Europartikel, Art. 23 GG für Deutschland verfassungsrechtlich Gestalt angenommen haben.
Zum Hüter der demokratischen und parlamentarischen Rechte im nationalen Rahmen entwickelten sich indessen nicht die Parlamente, sondern das Bundesverfassungsgericht in mehreren wegweisenden Entscheidungen. Das ist irritierend: „Die Parlamente in den Ländern und im Bund müssen den Willen zur politischen Selbstbestimmung aufbringen, betätigen und notfalls verteidigen wollen. Dass das Bundesverfassungsgericht den Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung an ihre durch das Grundgesetz begrenzte Kompetenz als Repräsentativorgane überhaupt erinnern muss, deutet auf einen Dissens über die Elementarfrage, wer Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt über die deutsche Staatlichkeit verfügt, wie die Bundesrepublik in eine europäische Föderation eintreten dürfte“ (Schorkopf, 411).
Parlamente und Gesellschaft
Eine wesentliche Aufgabe der Parlamente ist die „Vernetzung und Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten“ (Patzelt, 381f). Die „Regierten“ sind zunächst Bürger, zum Gegenüber des Staates werden sie jedoch als Glieder einer sich selbst organisierenden vielgestaltigen Gesellschaft. Die Themen, Interessen und Organisations- und Aktionsformen entwickelten und wandeln sich praktisch fortwährend. Kommunen, Vereine, Parteien, Kammern, Interessenverbänden, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen sind wesentliche Stichworte zu dieser sich ausdifferenzierenden Gesellschaft (Schulz, 55-66). Parlamente wurden neben den Regierungen zum Adressaten dieser gesellschaftlichen Organisationen, die zugleich ihre Agenda und ihre Handlungsspielräume beeinflussen. Was bei immer komplexeren Gesellschaften „zu immer komplexeren Netzwerkstrukturen um Parlamente herum führte“ (Patzelt, 381f).
Zu den historischen Konstanten gehört, dass die Regeln und die Politik des Staates, auch des parlamentarisch-demokratisch verfassten, und Interessen in der Gesellschaft in einem Spannungsverhältnis stehen, das erheblich sein kann. Die „Parlamentarisierung des Protests“ hilft, es abzubauen, und ermöglicht dem Gemeinwesen, sich weiterzuentwickeln. „indem zuvor unberücksichtigte gesellschaftliche Bedürfnisse und Forderungen eine parlamentarische Repräsentation gefunden haben“, wie sich am Beispiel der Grünen eindrucksvoll zeigen lässt. Allerdings mit Folgen für den Protest selbst, die nicht immer willkommen sind. Die jahrzehntelangen Konflikte zwischen „Fundis“ und „Realos“ bei den Grünen zeigen es. Es gibt eine „strukturelle Inkompatibilität zwischen Bewegungsaktivismus und Parlamentarismus“ (Schulz, 68f). Der Autor des Kapitels sieht die AfD vor einem ähnlich gelagerten Problem. Sie habe bisher „aus dem strukturellen Dilemma zwischen Systemopposition und parlamentarischer Opposition keinen Ausweg gefunden“ (Schulz, 71).
In den „immer komplexeren Netzwerkstrukturen um Parlamente herum“ verdienen noch andere Phänomene Aufmerksamkeit. Die Frage, wer wie über diese Netzwerke die Gesetzgebung beeinflusst, schlägt sich aktuell in Transparenzregeln oder Themen wie dem Legislativen Fußabdruck nieder. Es ist richtig, die Parlamente nicht zum parlamentarischen Arm mehr oder minder durchsichtiger Interessen werden zu lassen. Andererseits sind gesellschaftliche Akteure wie etwa der BUND im Gesetzgebungsverfahren auch schon privilegiert worden. Die Einschätzung, damit seien „Entscheidungs- und Gesetzgebungsprozesse demokratisiert“ worden (Schulz, 72), muss man nicht teilen. Denn wie sollen die Grenzen gezogen werden? Skeptisch sieht Schulz zumindest hochprofessionelle Akteursgruppen, die Menschheitsinteressen für sich reklamieren, deren politisches Mandat jedoch zweifelhaft erscheint, da sie weder durch Mitgliedschaft noch durch Unterstützernetzwerke demokratisch legitimiert seien (Schulz, 74f).
Leider gar nicht ausgeleuchtet wird das Phänomen, sogenannte zivilgesellschaftliche Akteure in einem Umfang zu fördern, bei dem sich die Frage stellt, ob sich in deren Engagement noch ein verbreitetes gesellschaftliches Bedürfnis zeigt, oder nicht vielmehr politische Vorfeldorganisationen alimentiert werden, die ihrerseits verstärkend auf den parlamentarischen Prozess zurückwirken, etwa als Sachverständige. Es fragt sich, ob die Parlamente damit nicht zugleich ihre Rolle als Vermittlungsinstanz zwischen Regierenden und Regierten schwächt. Denn ihre diesbezügliche Bedeutung schwindet ohnehin. Die politische Debatte, so scheint es zuweilen, hat sich in Talk-Shows verlagert, das Interesse der Medien richtet sich auf andere politische Mitspieler, wie NGOs oder soziale Bewegungen (Bösch, 250). Die Demoskopie belehrt die Regierenden besser als jedes Parlament über die Erwartungen der Regierten. Die Social-Media-Kanäle eröffnen ungeahnte Möglichkeiten direkter Kommunikation, durch die Parlamente, Parteien und klassische Medien in ihrer vermittelnden Funktion an Gewicht verlieren (Biefang, 47f).
Krise der repräsentativen Demokratie?
Der Blick auf die ausgewählten Problembereiche zeigt, dass eine historisch vertiefte Betrachtung das Verständnis politischer Gegenwartsfragen zu fördern vermag. Insoweit werden die Autoren dem selbst gesetzten Anspruch gerecht. Auf dem breiten Fundament greifen Dominik Geppert und Andreas Wirsching abschließend noch einmal die Frage auf, ob die parlamentarische Demokratie mit einer außergewöhnlichen „Krise der Repräsentation“ konfrontiert ist oder ob sich nicht vielmehr „die altbekannte Spannung zwischen Parlamentarismus und Demokratie lediglich neu aktualisiert“? Die Antwort ist ein wohlbegründetes Sowohl als auch: Das Muster sei nicht neu, „die Diagnose einer Spaltung zwischen Wählern und Gewählten, dem `Volk´ und seinen Regierenden, der parlamentarischen Demokratie stets inhärent“. Zugespitzt stellt sich die Situation nach ihrem Dafürhalten dennoch dar, weil sich die Differenz heute „zwischen professionalisierter politischer und medialer Elite einerseits und einer politikfernen, zunehmend individualisierten Gesellschaft“ auftue (Geppert/Wirsching, 418f).
Sechs Gründe greifen die Autoren, hier knapp zusammengefasst, heraus. 1) Die wachsende Komplexität der Herausforderungen. Abgeordnete müssen sich spezialisieren und auf externen Sachverstand zurückgreifen. In der Versuchung, Entscheidungen an die Wissenschaft zu delegieren, liegt eine Gefahr. Nicht allein weil dies „populistische Abwehrreflexe“ provozieren mag, wie in der Corona-Pandemie zu erleben war. 2) Die wachsende Komplexität überfordert erst recht die Wähler. Der Fluchtpunkt ist oft die bloße Meinung, die sich im Wirken des Parlaments nicht niederschlägt und nach der Idee der repräsentativen Demokratie auch gar nicht niederschlagen muss. 3) Diese gerät von zwei Seiten unter Druck: durch die oben bereits erwähnten Verflechtungsprozesse, die den Entscheidungsspielraum der Parlamente einschränken, einerseits und die Forderung nach außerparlamentarischer demokratischer Beteiligung andererseits, also nach „Resonanz statt Repräsentation“ (Hartmut Rosa). Die zum Teil herrschende Radikalität und Unbedingtheit steht für die problematischen Aspekte. 4) Der Anspruch „bislang unterrepräsentierter oder marginalisierter Gruppen“ auf Gleichstellung, die sich in den Quotendebatten zeigen. Das ist nicht per se undemokratisch, führte jedoch weg von der repräsentativen Demokratie hin zu einer „quasi neo-ständischen Gesellschaft“. 5) „Regieren im Kielwasser der Meinungsumfragen“, durch das sich Amts- und Mandatsträger „selbst in ihrer politischen Entscheidungsmacht lähmen“. 6) Den „Wandel der politischen Öffentlichkeit“, durch die digitalen Medien. Unter Verweis auf die deutlich unterscheidbaren Milieus der Kaiserzeit sehen die Autoren in den medialen „Echokammern“ der Gegenwart nicht unbedingt etwas ganz Neues. Das Neue besteht darin, mit welcher Wucht sie zur Waffe jener werden, die sich nicht repräsentiert sehen (Geppert/Wirsching, 419-426).
Die Verfasser sehen trotz ihrer Diagnose keinen Grund, in „einen allgemeinen politischen Kulturpessimismus“ zu verfallen, verweisen jedoch zugleich darauf, dass „Demokratisierung und Parlamentarisierung, historisch gesehen, keine Einbahnstraßen“ sind. Im „Bewusstsein dafür, dass die Kommunikation zwischen Parlament und Öffentlichkeit für die Akzeptanz der Institutionenordnung wesentlich ist“, sehen sie einen entscheidenden Ertrag neuerer Forschung (Geppert/Wirsching, 426f). Und: „Am Ende ist die Funktionsfähigkeit des Parlamentarismus der Prüfstein, der über Stabilität und Krise des politischen Systems entscheidet“ (Geppert/Wirsching,428).
Der eingangs zitierte Deutschland-Monitor illustriert den Befund und zeugt von einer erheblich gestörten Kommunikation zwischen Parlamenten und Öffentlichkeit. Die Gruppe der „angepassten Skeptiker“, die von der Politik im Grunde nichts mehr erwarten, und der „verdrossenen Populisten“ die mit der deutschen Demokratie extrem unzufrieden sind, beläuft sich in Summe in Deutschland unterdessen auf 52 Prozent, im Osten des Landes gar auf 61 Prozent (DM2022, 100). Mehrheitlich meinen die Bürger die Parteien interessierten sich nicht für ihre Ansichten, sondern nur ihr Wählerstimmen, und nur eine Minderheit meint, dass den Politikern das Wohl des Landes wichtig sei. „Nur noch 43 % der Ost- und 58 % der Westdeutschen vertreten den Standpunkt, dass man in Deutschland seine Meinung immer frei äußern kann, `ohne Ärger zu bekommen´“ (DM2022, 92). Gerade die Zahlen zum Stand der Meinungsfreiheit verweisen auf die enorme Bedeutung der gewandelten politischen Öffentlichkeit.
Zusammengefasst: Die Krise ist hinlänglich beschrieben und in dem Sammelband historisch sachkundig eingeordnet. Den Gefahrenpunkt und die Herausforderung der Gegenwart fasst ein weiterer Herausgeber, Andreas Biefang, sprachlich präzise: „Die Polarisierung von Parlament und `Volk´, das aus der Sicht der Eliten schnell wieder zum `Pöbel´ werden kann, während Teile der Gesellschaft in der Volksvertretung keine legitime Repräsentation mehr sehen, ist in der Geschichte der parlamentarischen Demokratie von Anfang an angelegt. Wo sie sich zur Repräsentationskrise verdichtet, ist Klugheit der politischen Akteure gefragt“ (Biefang, 49). Man gewinnt aktuell nicht den Eindruck, dass das angekommen ist. Der Sammelband kann dazu beitragen, dies zu ändern.
Karl-Eckhard Hahn