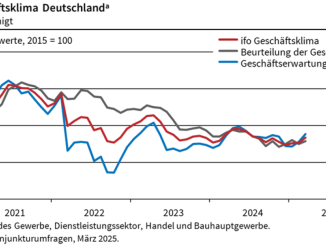Ein Undankbarer, dieser König Admète. Kann er denn nicht anders, als sich als Macho zu gebärden? Das tut er aber, und ausgerechnet dann (wieder), wenn ihm das schon finale Leben wiedergeschenkt wird – von seiner Gattin Alceste. Sie opfert sich in einzigartiger Generosität für ihren Gatten auf dem Königsthron von Thessalien. Nehme er hin, was ihm gebührt! Doch Admète fährt aus der Haut: Wer habe dem Weib an seiner Seite das Recht gegeben, über ihn, den Herrscher, zu verfügen? Die Königin fühlt sich so emanzipiert, ihrem Ehemann ihr Leben zu schenken. Sie stirbt, damit er lebe.
Es fällt nicht leicht, sich in die mythologisch-aufklärerische Atmosphäre hineinzudenken, in die Christoph Willibald Glucks Tragédie-opéra in drei Akten „Alceste“ (Pariser Fassung, Originalsprache) den Zuseher führt. An der Bayerischen Staatsoper hat dieser es doppelt schwer: Vom ersten Ton an, den der ambitionierte Ex-Violinist und Dirigent Antonello Manacorda im Orchestergraben anschlagen lässt, ist er gefesselt – aber auch zunehmend genervt – von einem Bewegungs-Ballett der ausgefallensten Gliedmaßenverrenkungen und Bodenturnübungen, die man ihm zumutet. Hat er überlesen, wer hier Hand an die Barockoper von 1776 legte? Der Kultchoreograph Sidi Larbi Cherkaoui wurde mit seiner 2010 gegründeten Compagnie Eastman geholt. Tat`s der Staatsballett-Direktor Igor Zelensky nicht? Diese Frage drängte sich immer mehr auf, je weniger schlüssig und virtuos die – im Programmheft star-gleich mit Voll-Biografie einzeln erwähnten – Gäste aus Holland tanzten. Glucks Musik, die ebenso wie ihre „Vertanzung“ dringend größerer Striche bedurft hätte, folgen die Eastmans zwar, dienten ihr aber ebenso wenig wie der ganzen leidvollen Geschichte.
Beim Publikum der Zweitaufführung kam der akzeptabel musizierte Tanzabend vor nüchtern-grauer Bühnen-Wandtäfelung (Henrik Ahr) trotz eines gelangweilt wirkenden, freudlos beteiligten Staatsopernchors und total fehlender Personenregie mit sinnstiftenden Auf- und Abgängen von Protagonisten und Choreographierten recht gut an. Missfallensäußerungen wie bei der Premiere blieben aus. Zugegeben: Ein probates Solisten-Ensemble wurde auf die kultchoreographischen Praktiken des vor 2 Jahren für Rameaus „Les Indes galantes“ erfolgreich nach München beorderten Cherkaoui eingeschworen. So zeigte Charles Castronovo als Admète, dass er auch einen glänzenden Rodolfo oder Tamino drauf hat, machte Michael Nagy in der Doppelpartie des Oberpriesters und Hercule keine schlechtere Figur als kürzlich für Amfortas und Wolfram und bewies die junge drahtige, hell und verlockend klingende Anna El-Khashem als erste der Coryphées ihre Vorrangstellung im hauseigenen Opernstudio.
Da wäre noch die Titelfigur, die Sidi Larbi Cherkaoui und Intendant Nikolaus Bacher der Flensburger Sopranistin Dorothea Röschmann anvertrauten. Unvorteilhafter als sie war kein Akteur kostümiert (Jan-Jan Van Essche) und (fürs Programmbuch) frisiert. Gesanglich und figürlich kann sie durchaus noch an ihre überzeugenden Desdemona- oder Donna Elvira-Interpretationen anknüpfen. Es genügte allerdings nicht, die Königin Alceste zu spielen, es galt auch, sie so hochherrschaftlich nobel zu singen wie wenigstens die Letzte aus der Reihe der großen Alcestes, angeführt von Maria Callas und endend bei Jessey Norman. Dass die Alceste Trauer tragen muss, wenn sie den nahen Tod Admètes beklagt oder am Tor zur Unterwelt mit grässlich stakenden schwarzen Vogelscheuchen steht, ist klar. Dass dies aber statt mittels erregenden Prachtgesangs („Divinetes du Styx“) geschieht, sondern mittels überlanger schwarzer Tücher, die der Beklagten um den Leib geschlungen und wieder abgewickelt werden, ist eher lachhaft als dass es Mitleid erregte. Die ganze Aufführung berührt nicht. Sie lässt kühl und an die Ära Peter Jonas denken, die Münchner Barock-Opern zu bleibenden Ereignissen werden ließ.
Foto: Für das „Alceste“-Programmbuch gezeichnet: verdichtete Netzstrukturen von Susan Hefuna