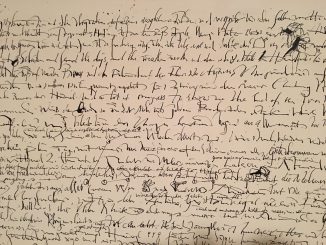Die Kunst der Modere und die zeitgenössische Kunst sind en Vogue, Millionen werden auf dem Kunstmarkt geboten. Doch Martin Mosebach legt sein Veto ein. Eine Kunst ohne Form und Regeln vermag, so der christliche Denker, der gerade seinen neuen Roman „Die Richtige“ vorgelegte hat ein großes Manko. Einerseits verliert mit ihr das klassische Ideal der Schönheit an Relevanz, anderseits verdrängt sie die Wahrheit und verlässt damit die große Tradition, aus der sie entsprang. Schönheit bleibt Gnade, so der Bestsellerautor. Von Stefan Groß-Lobkowicz.
„Die Kunst ist lange bildend, ehe sie schön ist“, schrieb einst Johann Wolfgang von Goethe wie Martin Mosebach ein Sohn der Stadt Frankfurt/Main. Kunst, so der spätere Weimarer Dichterfürst und Empiriker Goethe, der anders als sein Künstlerkollege Friedrich Schiller in Wissenschaft und Kunst ganz aristotelisch vom Einzelding zur Idee aufstieg, war doch felsenfest davon überzeugt, dass es Regularien bedurfte, die ein Kunstwerk zu einem Schönen mache. Ein Rubriken-Schema hatte er dazu entworfen, Skala und Bewertungsrichtmaß zugleich. Alles, so Goethe, was sich Regel und Zweck entzieht, im wohligen Erleben wilde Feste feiert, in der Gefühlsduselei förmlich ertrinkt, als Herzensergießungen die Seele sinnestrunken erhebt oder schaudern lässt– sein kritischer Blick auf die Romantik genügt – all dies ist dem Kunstschönen abträglich, bringt eine Seichtigkeit ans Licht und führt in die Verflachung. Bekanntlich galt bereits für Aristoteles nur das als schön, was einen Zweck habe, auf den es zusteuert. Das Bewertungsmaß, was denn schön sei, war jeweils der Status der erreichten Umsetzung hin zum Ziel, quasi der Maßstab des immanenten Fortschrittes.
Der Fortschritt und der Zeitgeist – Die Kunst im Verfall
Der große Kunsthistoriker, Vater der Kunstgeschichte, Giorgio Vasari folgte dieser Spur des Fortschritts in der Kunst und der neuplatonisch inspirierte Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury, lobte in Analogie auf die neuplatonische Metaphysik Regelmaß und Proportion als Ausweis des Göttlichen. Die Kunst rief er damals im Namen der Tugend zur Ordnung und schrieb sich die Verschmelzung von Schönheit, Wahrheit und Tugend mit Blick auf die Antike auf seine Agenda. Ihm ging es um nichts weniger als um die Kultivierung der Affekte, die moralische (Selbst)Erziehung der Person und das gemeinsame sittliche Handeln in Staat und Gesellschaft. Mit Blick auf den Fortschrittsgedanken in der Kunst kritisierte bereits Jean Jaques Rousseau den Hang zum Gefälligen in der Kunst und den Künstler, der sich dem Zeitgeist unterwirft. Er diagnostizierte einen Verfall der Kunst, insbesondere, wenn diese nur an die Sinnlichkeit appelliere und sah eine Häresie in der Übertreibung des Gefälligen am Wirken. Aber nicht nur Rousseau blickte in seinem „Diskurs über die Wissenschaften und Künste“ (1750) auf den Fortschritt der Kunst als Niedergang, der für die Kunst insgesamt ein Verderben sei, auch der Deutsche Johann Joachim Winckelmann, der Begründer der Kunstwissenschaft, diagnostizierte in seinem Manifest des Klassizismus, seinem Werk „Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst“ (1755) die Verderbtheit des Zeitaltes und forderte, sich an den griechischen Künstlern zu orientieren. „Die edle Einfalt und stille Größe der griechischen Statuen ist das wahre Kennzeichen der griechischen Schriften aus den besten Zeiten, der Schriften der Sokrates‘ Schule.“ Das Wesen der Kunst sah Winckelmann in der Verkörperung göttlicher Schönheit, und ganz platonisch gab es absolute Schönheit nur in Gott, gleichwohl der Begriff menschlicher Schönheit vollkommener erscheine, je mehr er mit dem höchsten Wesen harmoniere. Das höchste Ziel der Kunst bleibt für den berühmtesten Sohn der Hansestadt Stendal die Erreichung einer idealen Schönheit den Vorbildern der griechischen Antike auf den Spuren.
Das Ende der idealischen Schönheit
So idealisch das Schönheitsringen von Goethe und seinen Kunstfreunden gewesen sein mögen – im Zeitenschub von Industrialisierung und Säkularisation hat sich das Wesen der Kunst verändert. Sie ist vom Götterhimmel hinab in die Endlichkeit gestiegen. Wo einst Schönheit und Idealmaß den Ton angaben, regieren in der zeitgenössischen Kunst Regel- und Formlosigkeit. Statt Kunstmaximen wilde Exzesse – und dem einstigen objektiven Kanon gegenüber hat sich die subjektivistische Kreativität geschoben, für die alles erlaubt scheint. Statt Form herrscht seit dem 20. Jahrhundert und spätestens mit der Postmoderne diverse Fülle und Simulacren, Verschiebungen und Verweisungen, aber keine ursprüngliche Idee als die formgebende Quelle. Für den französischen Semiotiker und Poststrukturalisten Roland Barthes hat das Anti-Logozentrische seine Säulen aufgerichtet. Ein Kunstwerk verweist nicht mehr auf seinen transzendenten und idealen Gehalt, ist nicht mehr Spiegelbild göttlicher Ordnung und Form, sondern konstruiert sich als „Simulacrum“ permanent neu, woraus eine Welt entsteht, „die der ersten ähnelt, sie aber nicht kopieren, sondern einsehbar machen will“. Auch für den französischen Poststrukturalisten Jacques Derrida ist vom Transzendenten nur die Spur geblieben, aber selbst diese ist keine, die auf ein Anwesen des Schönen und der Kunst verweist, sondern eine Spur, die sich permanent auflöst, verschiebt, verweist, eigentlich gar nicht stattfindet und zu deren Wesensstruktur das Erlöschen Struktur gehört.
Gegen die Verflachung der Kultur
Gegen diesen Schub hin zur Relativierung und dem Aufrichten eines Diktats des Relativismus in der Kunst, gegen diese „Häresie der Formlosigkeit“, gegen die postmoderne Beliebigkeit und die Auflösung des Wahrheitsbegriffes in der Kunst, rebellierte schon früh einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller der Gegenwart – Martin Mosebach. Nach dem Tod der Großschriftsteller Martin Walser, Günter Grass und Hans Martin Enzensberger ist Mosebach als Chronist der modernen deutschen Literatur übriggeblieben. Wie ein Fels in der Brandung vertritt er die Leuchtkraft der platonischen Idee, entzündet die Kerze für eine Kunst, die sich im Absoluten spiegelt. Gegen die Verflachung und Verelendung und gegen die Form- und Konturlosigkeit der Kunst stellt er die Sehnsucht des Menschen nach dem Schönen und Wahren wieder her, er steigt zurück in die Zeit der Antike, des frühen Christentums und zu Michelangelo und Raffel, in das goldene Barock – in die Zeiten, bevor die Romantiker betonten, dass die Kunst inkommensurabel sei und auf keinen anderen Zweck als auf den des Künstlers, er selbst zu sein, angelegt ist.
Für Mosebach – den Solitär und ästhetischen Reaktionär – bleibt Schönheit Gnade. Auch in den Zeiten des „Alles ist möglich“, ist die Sehnsucht des Menschen nach dem Schönen und Wahren eine anthologische Konstante – so die Maxime eines bekennend religiös Musikalischen. Und wie für Goethe und Winckelmann bedarf es eines Formenkanons, in welchem sich die Schönheit nicht nur zeige, sondern es muss auch ein Klassifikationsschema existieren, was als schön und als nicht-schön eingeordnet werden kann.
Der Zeitgeist in der modernen Architektur
Nicht umsonst preist der studierte Jurist als bekennender katholische Autor die Zeiten, wo Kirchen noch Schatzhäuser waren, wo sich das Beste, was die Kunst der Epoche zu leisten vermochte, zum Lob und Preis Gottes, zur Feier der Heiligen Messe – und in ihrem Mittelpunkt, die Liturgie, versammelte. Der Modernisierungsschub, der mit dem technischen Fortschritt, mit dem Funktionalismus und Brutalismus in die Architektur der Kirchen Einzug hielt, die neue geistlich-geistige Sparsamkeit, die darauf hinauslief, das Heilige gegen das Profane zu tauschen, das Pompöse gegen das Karge, das Anmutende gegen das Funktionale, die Grazie und das Erhabene der Kunst entkernte und in wesenslosen und schlichten Bauten verkümmern ließ. Diese neuen Bauten samt Innenarchitekturen mögen zwar dem Zeitgeist huldigen und dem modernen Individualismus als Kathedrale der Selbstinszenierung Ausdruck verleihen, allein mit dem Wunder und der Herrlichkeit Gottes haben diese wenige zu tun.
Nun hätte Mosebach nichts gegen den schlichten Ritus der Urchristen während ihrer Verfolgung in den Katakomben. Was den Literaten aber missfällt, bleibt, dass Schönheit generell in Misskredit gerät. Schönheit ist eben nicht mehr die Pracht, sei es des Rokokos oder des Barocks, nicht mehr die in den Himmel steigenden überirdisch anmutenden gotischen Kathedralen, die samt ihrer Helligkeit den himmlischen Glanz des göttlichen Lichtes widerspiegeln, sondern der Verdacht, dass alles, was aus dieser christlichen Tradition stammt – unter das Kuratel des Überholten und Unzeitgemäßen gestellt wird. Der tschechische-österreichische Architekt Alfred Loos hatte in einem Vortrag einmal Ornament als Verbrechen bezeichnet – und damit alles Barocke und Zierrat in Diskredit gebracht. Der Prozess, dass die Schönheit aus Christentum und Antike im Verblassen ist, bleibt also kein Befund der Nachmoderne, allein seit der Romantik verspielt sich das objektive Ideal der Schönheit.
Schönheit ist verdächtig geworden
Der Trend der Zeit, so die Kritik Mosebachs, liege in Aufhebung der platonischen Trias des Wahren, Guten und Schönen – selbst diese vom Christentum adaptierte Idee verliert an Relevanz, wenn Gott vom Himmel auf die Erde gezogen, wenn das Religiöse nur noch Spielball eines ästhetischen Kulturverfalls ist, der sich gerade dahingehend aufschaukelt, dass er die Wahrheit aus dem Diskurs verdrängt, diese zum Anhängsel macht, was sich darin zeige, Schönheit als Makel zu definieren. Was schön ist, ist per se verdächtig, weil es auf Formen und wieder auf ein Unbedingtes verweise, dessen Existenz aber in Frage gestellt wird, weil es sich in den Nischen der Beliebigkeit, als den neuen Behausungen der rein auf sich fokussierten Existenz, zurückgezogen habe. Der Kultur der Moderne liege als Befund zugrunde, das Erhabene nicht mehr sichtbar zu machen. Erhabenes und Schönes, einst Kategorien, die ein Kunstwerk zu einem Besonderen machten als Ausweis seiner gespiegelten Göttlichkeit. „Das, was viele Menschen als äußerste Schönheit erlebten, war nichts anderes als der Glanz der Wahrheit“, betont Mosebach.
Wahrheit ist unmodern geworden, weil die Gesellschaft sich das Pluralistische als das neue Heilsbild auf die Fahnen geschrieben hat – und nur noch das zählt, was divers und in seiner Zerstreutheit, in seiner offenen Interpretierbarkeit und damit in der Aufwertung des Interpretierten seine Authentizität erfährt. Wahrheit reduziert sich damit auf den Fokus des Subjektes, das das Kunstwerk erst in seinen Deutungshorizont bringt und sich dieses erst aneignet, beziehungsweise, das Werk konstituiert und vollendet sich erst im Auge des Betrachters.
Für eine neue Synthese
Entgegen dieses Trends plädiert Mosebach für eine Synthese aus Antike und Christentum, aus dem Logos einerseits, der das Transzendente in das Sein vermittelt, wie andererseits auf ein Christentum, das – im Unterschied zur griechischen Philosophie des Platon – nicht leibfeindlich ist, sondern sein Wesen und seine Modernität gegenüber der Antike gerade in der Einheit von Leib und Geist begreift. Die Aufgabe der Kunst im Sinne Mosebachs im Zeitalter des Profanen müsste dann in der Rückeroberung der verlustig gegangenen Domäne liegen. Im Geistigen gilt es, sich an die Wahrheit zurückzubinden und im Sinnlichen müsse sich das Geschenk des Göttlichen spiegeln. Mosebach formuliert es so: „Die Sinne seien eben nicht nur Täuschungen ausgesetzt, sie seien auf Grund der Fähigkeit, Schönheit wahrzunehmen, in hohem Maße wahrheitsfähig, erklärte der Schriftsteller. Die Seele wolle sich auf die Schönheit zubewegen. Über das Schöne lasse sich nicht abstrakt philosophieren, es bedürfe keiner Begründung im Sinne logischer Deduktion. Das Unendliche werde gerade durch die Schönheit erahnbar.“
Ganz so resignativ wie manche Spötter dem ästhetischen Reaktionär Mosebach unterstellen mögen, ist dessen kritischer Blick auf die Schönheit keineswegs. Selbst wenn er bekennt, dass dieser aus der Mode sei, heißt es doch nicht, dass dieser schon zu Grabe getragen sei. Für Mosebach keimt Hoffnung dort, wo es Rubriken und Ordnung gibt, nur auf diese müsse man sich eben besinnen – und wenn man diese in der Kunst wieder zu Grunde legt, wenn man sich an die überlieferten Gesetze des Kirchenbaus halte, entsteht auch in unserer Zeit heiliger Raum. Aus der Originalität solle die Kirche erwachen. Es gelte Ballast abzuwerfen und wieder Schönheit zu finden. Sein Credo bleibt: „Wir haben in unserer Unfähigkeit zur Schönheit die neue Gelegenheit, die Schönheit als etwas nicht von uns selbst Gemachtes zu erfahren, sondern als Offenbarung und Gnade zu entdecken – als etwas, das hinzutreten mag, wenn man in aller Bescheidenheit nichts anderes will, als die vorgegebenen Regeln zu befolgen, und nichts als das im Sinn hat. Schönheit – das ist der Glanz des Richtigmachens.“