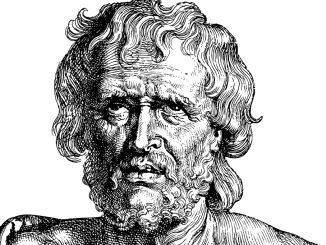Bereits der große russische Schriftstelle Fjodor Michailowitsch Dostojewski bekannte: „Ohne Heimat sein heißt leiden“. Die Zeiten von Globalisierung und Virtualisierung sowie der postmoderne Rausch, die Identität zugunsten von Simulakren aufzugeben, letztendlich die personelle Identität auf dem Schafott der Dekonstruktion zu opfern, haben nicht nur der Person geschadet, sondern ihr ihren Wesenskern teilweise entzogen, das Ursprüngliche wurde zum Biederen erklärt. Nichts war schlimmer als das Bekenntnis zur familiären Verortung in Raum und Zeit.
Wer sich zur Heimat, zu den Werten und Traditionen bekannte, galt als Hinterbänkler, als einer, dessen Zukunft verwirkt war, als einer der buchstäblich im Gestern lebte – reaktionär und konservativ – schlicht zukunftsvergessen. Jahre zuvor hatten die 68er der Heimat und all ihren positiven Assoziationen endgültig eine Absage erteilt und diese zur Spießeridylle, umgeben von der schnöden Mentalität des Provinziellen, erklärt.
Und auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts trat man auf das Gaspedal der Beschleunigung, der heimatliche Resonanzraum galt als stigmatisiert. Und so hatte sich im rasenden Alltag der Metropolen, in der Expressgeschwindigkeit der Zumutungen der Unbehausten, das verflüchtigt, was dem Menschen Rettungsseil ist: der Zauber des Innehaltens und der Raum des Sich-Geborgen-Fühlens. Anstelle von Heimat trat das globale Dorf, das die Menschen in sich hinein und aufsog. Geblieben ist für viele nur die nackte Existenz, die Heimatlosigkeit.
Doch dem Beschleunigungsdrall samt Entfremdung wächst nunmehr die Sehnsucht nach der verlorenen Idylle entgegen. Statt auf Innovation setzt man auf Traditionen, kehrt als Entwurzelter zurück in die Orte der Wiegenlieder. Selbst unter der Jugendlichen erweckt der Begriff Heimat wieder etwas Positives.
Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben acht von zehn Menschen in Deutschland positive Assoziationen, wenn sie über diese nachdenken. Und gerade die jüngsten Befragten im Alter von 18 bis 29 Jahren sind es, bei denen das Positive mit 74 Prozent überwiegt. Statt dem Run auf die Metropolen samt ihrem rasenden Stillstand letztendlich folgen viele wieder der Stimme des Herzens, von den lichtüberreizten Himmeln der Großstädte hin in die bedächtige Einsamkeit ihrer verträumten jugendlichen Heimstätten. Eine Erinnerungskultur an Verlorenes richtet sich spürbar auf. Und auch der Reiz des Landlebens erfährt, wie bereits vor 200 Jahren, eine neue Renaissance, weil für viele die verlassene Heimat stets eines geblieben war: ein Sehnsuchtsort der Geborgenheit. „Mit heißen Tränen wirst du dich dereinst Heim sehnen nach den väterlichen Bergen“, heißt es bei Friedrich Schiller. „Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern / ein einsam Leben führt“, dichtete sein Weimarer Musenfreund Johann Wolfgang Goethe. Heinrich Böll wird im 20. Jahrhundert hinzufügen: „Heimat ist immer noch Sehnsucht nach der Kindheit.“
Auch der 2015 verstorbene Philosoph Odo Marquard betonte in seinem philosophischen Essay „Zukunft braucht Herkunft:“ „Mehr als die Herkunft Zukunft benötigt, braucht die Zukunft Herkunft.“ Auf Herkunft ist das Haus des Seins gebaut, allen Modernisten zum Trotz, denn: In den Stunden des Lebens, wo die großen Sinnfragen die Existenz befallen, ist es die Herkunft, die Erlösungscharakter trägt. Für die Christen jedoch ist es vielleicht ein wenig einfacher, denn sie haben ihren Lebenssinn nicht nur in die Flüchtigkeiten eines vielleicht banalen Alltages gelegt, sondern neben ihrer Heimat auch die göttliche gefunden. Diesen Trost fasst Hildegard von Bingen so: „Des Menschen Heimat ist Gott, und dem Geheimnis von Gottes Liebe verdankt er seine Entstehung. Der Mensch ist ein Bild Gottes und ein Partner aller Kreaturen der Welt. So war es Gottes Plan von Anfang an.“