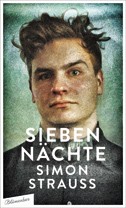
Simon Strauss. Sieben Nächte. Berlin (Aufbau Verlag/ Blumenbar) 2017. 144 S., 16 Euro. ISBN 978-3-351-05041-2.
Der Auftakt zu dem von den sieben Todsünden verdunkelten Nächten des Ich-Erzählers ist pop-artig und endzeitlich-existentialistisch zugleich: Und die Ideengeber? Die berühmte Poprock-Gruppe The Kinks, die in den späten 1960er Jahren die Herzen der Teenies mit dem Song über den Bachelor-Dandy entflammte, und Gottfried Benns Sinnsuche-Gedicht über die Leere und das fernbestimmte Ich. Und was verbindet die Ideen der beiden Leitmotivgeber? Die Angst davor, erwachsen geworden zu sein, ohne Initiationsritual, „ohne Reifeprüfung einfach durchgerutscht (zu sein) bis zur Dreißig.“ So leitet der Ich-Erzähler seine Bekenntnisprosa ein. Sie gleicht einem Aufschrei, in dem ein junger Intellektueller seinen Frust über seine verfluchte Angepasstheit an die Normen einer durchritualisierten Gesellschaft über Seiten hinweg dem Leser vorjammert. So lange, bis er sich gesteht: „Ich will wieder den Wunsch nach Wirklichkeit spüren, nicht nur den nach Verwirklichung. Ich will Mut zum Zusammenhang, zur ganzen Erzählung.“ Und wie will er es anpacken, um die „Neubauten ohne Einsturzgefahr“ zu errichten? Mit Ideen „ohne feste Ordnung, Utopien ohne berechenbaren Sinn, nach Ecken und Kanten, an denen ihr euch stoßen könnt?“ Doch die Suche nach denjenigen, die noch „Lust am Planen und Träumen“ haben, erweist sich als sinnlos, denn der Sinn suchende Ich-Erzähler ist einsam, verliebt in seine Einsamkeit, die er im dritten Stock eines Altbaus so lange zelebriert, bis die Angst ihm den Mut verleiht, aufzuschreien.
Und der verzweifelte Hilferuf: „Ich will kein Niemand sein“ wird erhört. Ein Unbekannter – die Verführung in der Gestalt eines Beelzebubs – verspricht ihm etwas Verlockendes und Aufregendes zugleich. Ein Angebot, das er annehmen wird: in sieben Nächten, auf Streifzügen durch die Stadt alles auszuprobieren, was lustvoll und wollüstig ist, was von Habgier, Neid, Faulheit, Hochmut und Jähzorn zeugt. Es sind Orte, die nicht unterschiedlicher sein können: Hochhaus, Fleischrestaurant, Wohnung, Trabrennbahn, Universitätsbibliothek, Maskenball und Autofahrt. Sie sind im Glossar sorgfältig mit Zeitangaben und lateinischen Begriffen für die jeweilige Todsünde verzeichnet (schließlich ist der Autor ein promovierter Altertumswissenschaftler!). Es geht los mit Superbia, der hochmütigen Verachtung der Bettler, Alkoholiker, Schwarzfahrer, der radelnden Jungväter und all der politisch korrekten Feiglinge, die Angst vor allem haben, die den Sprung ins Ungewisse nicht wagen, im Gegensatz zu dem Ich-Erzähler, der den Fall vom Hochhaus angeblich sicher und heil überstanden hat, der damit ein offiziell anerkannter Schwerkraftbesieger geworden ist. Einer, der dem Tod in die weißen Pupillen gesehen hat, einer, der sich sofort aufmacht, um die Macht zu übernehmen, einer, der diktatorisch die Wohnhäuser besetzen wird, so dass alle Bewohner einander fremd sein werden (verhindert die landesübliche Doppelmoral!). Mehr noch: Tiere sollen als Ordnungshüter eingesetzt, neue Akademien gegründet werden, in denen Gefühle, nicht Theorien der Gegenstand der Forschungen sind. Allein, die Erfüllung der Träume scheitert daran, dass er alles geben will, aber dennoch nur angeseilt vom Hochhaus gesprungen und damit die Machtprobe gescheitert ist. Auch die Völlerei im Fleischrestaurant endet nur mit einem sanften Bekenntnis, weil er Fleisch isst, um sich selbst „und seiner Zeit zu widersprechen“ und seinen Fleischgenuss mit einem religiösen Motiv begründet.
Und die Faulheit? Sie steht im offensichtlichen Widerspruch zu seinem Wunsch, dass irgendjemand ihm zuschaut, wenn er in seiner Wohnung irgendwelchen Gedanken nachhängt. Und die Habgier, die er als Zuschauer und Lotto-Spieler auf der Pferderennbahn empfindet? Kommt die etwa ins Spiel, wenn er bescheidene Einsätze auf irgendwelche Rennpferde setzt, die ohnehin nicht gewinnen?
Viel deutlicher sind da seine Eingangsüberlegungen, wenn er über die Todsünde Neid (invidia) nachdenkt und mit einer ziemlich überraschenden Feststellung beginnt: „Wahrscheinlich sind wir zu wenig vom Teufel besessen.“ Ach ja. Und wie lautet der Ausweg? Uns fehlt einfach die Mantra der Jugend: die Wut. Und warum hat uns die Wut, die Revolte auf die so gearteten Verhältnisse verlassen? Die Ursachen dafür erweisen sich als diffus. Früher, ja da waren die Bibliotheken noch Horte des Nachdenkens, heute da sind sie nur noch Servicestationen, in denen die Bücher nur noch Platzhalter sind. Früher, so stellt sich der Ich-Erzähler die jüngste Vergangenheit vor, da sei so viel kaputt gewesen, was wieder aufgebaut werden musste. Außerdem habe es damals noch Zorneslust beim Lesen der Zeitung gegeben, da habe es noch Gegner gegeben, echte Feinde, da habe die Revolte unserer Vormütter und –väter „auf den hohen Absätzen der Theorie“ stattgefunden. Und heute? Da „fehlt das Feuer. Der Mut. Wir ewigen Zweiten.“ Und die Wollust? Wird diese Sünde, die „zwischen Schönheit und Verzweiflung“ ihre zahmen Orgien feiert, dem Erzähler endlich Erlösung von seinen sinnlichen Qualen bringen? Wieder schlüpft er in die Rolle des Beobachters, zitiert Schiller und Beckett, vergleicht die lüsternen maskierten Partymädchen mit einer berühmten Bronzestatue von Rodin, und wenn ihn nicht ein Mädchen aus dem Hinterzimmer verführt hätte, dann wäre auch diese Nacht ohne Todsünde vergangen. Und der immer wieder eingeforderte Jähzorn? Die Diagnose fällt, wie zu erwarten, negativ aus: „Der Zornige ist ein Kranker geworden. Ein Radikaler, der den wohligen Gemütszustand der Menge gefährdet.“ Da hilft nur der Blick zurück in die Antike. In Athen und Rom, da sei der Zorn eines jungen Redners „die Feuerprobe auf seinen Charakter“ gewesen. Nur der Feuerkopf sei damals kein eitler Blender gewesen, im Gegensatz zu heute, wo „das Ideal des Widerstands … zur fadenscheinigen Geste (verkommen ist)“. Ein spontanes Urteil, das sicherlich für die (noch) unentschlossene junge Mittelschichtsgeneration zutrifft, spätestens jedoch beim schärferen Blick auf die Aktionsfelder der allmählich wachsenden links- und rechtsorientierten Jugend fragwürdig ist. Und der enttäuschte spätjugendliche Protagonist? Er schreibt kurz vor dem Eintritt in das Erwachsenenalter seine Botschaft in den Sand, aber nur „aus Hoffnung, dass da noch was kommt.“ Und? Was wird kommen? Überraschung! Der Autor liefert noch einen Abgesang vor dem Ende seiner in der Haltung so unentschlossenen „Sünden-Bekenntnisse“. Es ist ein Brief an sich selbst mit der Botschaft: Reifeprüfung bestanden und nun geht’s ab in das echte Leben. Also in das Leben des angepassten Bürgers? Der Autor, Jahrgang 1988, hat mit seiner Debütprosa einen lobenswerten Appell an ein akademisches Prekariat geschrieben, das aus der Zukunftsvision einer gerechteren Gesellschaft zurückgekehrt sich bestenfalls noch für elementare bürgerliche Rechte einsetzen wird. Ein Aufschrei der enttäuschten jungen Generation ist daraus leider nicht geworden. Wie schade!






Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.