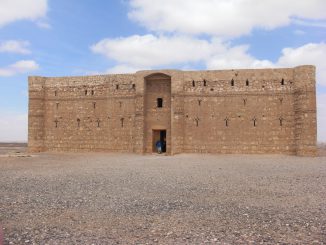Noch im Winter 1944/45 hatte, obwohl amerikanische Truppen bereits auf deutschem Boden standen, ein NSDAP-Redner aus Coburg vor dem Rodacher Rathaus den andächtig lauschenden Zuhörern den „nahenden Endsieg“ verkündet. Davon sprach jetzt, wo amerikanische Panzerverbände unaufhaltsam Richtung Bayern vorstießen, niemand mehr.
Dass irgendetwas Schreckliches auf Rodach zukäme mit dem Vormarsch der Amerikaner, das war uns Kindern bewusst, denn zur Verteidigung Rodachs waren mehrere Panzersperren errichtet worden. Am Bau dieser Sperren beteiligt war der Rodacher „Volkssturm“, zu dem zu meiner Verwunderung auch unser Nachbar Ewald Leuckart gehörte, der Besitzer der Glanzgoldfabrik Rodach uns gegenüber. Wenn man in der Innenstadt einkaufen wollte, musste man jetzt, um die Panzersperren zu umgehen, an der Hausers Villa in der Heldritter Straße durch den Garten laufen und konnte bis zuletzt durch eine kleine Tür in der Panzersperre in der Coburger Straße den Markt erreichen. An den Kellerfenstern unserer Glanzgoldfabrik in der Heldritter Straße hatte unser Arbeiter Gustav Weber aus dem Dammüllersweg die Gitterstäbe herausgemeißelt, damit man fliehen konnte, wenn es brennen sollte. Er hatte auch im Hühnerstall eine Grube ausgehoben und eine schwarze Eisenkiste darin versenkt mit unserem Tafelsilber und anderen Wertgegenständen. Eine Holzkiste mit Lebensmitteln in Einweckgläsern hatte er in unserem riesigen Aschehaufen im Obstgarten vergraben.
Und dann fiel auf einmal die Schule aus! In der Osterwoche, noch im März, schickten uns die Lehrer nach Hause, ohne uns wissen zu lassen, wann diese unendlich langen Ferien, die bis in den Herbst hinein andauerten, denn zu Ende gingen. Meine Mutter hatte beschlossen, dass wir alle, Verwandte und Bekannte, den Angriff der Amerikaner auf Rodach im Gewölbekeller unserer Fabrik überstehen sollten. Friedel Wölfert und Marga Wietzel aus dem Dammüllersweg kamen, als schon ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug über Rodach kreiste, leichtsinnigerweise über die Felder zu unserem Grundstück gerannt. Einer der deutschen Soldaten in unserem Garten, der die Feindlage erkunden wollte, stieg in voller Uniform ins Dachgeschoss unserer Fabrik und öffnete das Fenster nach oben. Eine Viertelstunde später schossen die Amerikaner zwei Granaten in die ersten Stockwerke von Wohnhaus und Fabrik. Im Wohnhaus durchschlug das Geschoss den Kleiderschrank meiner Eltern und verteilte Fetzen von Anzügen und Schlipsen meines Vaters, der 1944 in Lettland in russische Gefangenschaft geraten war, auf den umstehenden Apfelbäumen.
Und dann hörten wir, als wir nach dem Angriff aus dem Keller in den Garten hochgestiegen waren, wie die Scheune in Fladts Bauernhof schräg gegenüber brannte. Das war so laut, dass man sich kaum noch verständigen konnte. Die Kühe brüllten im Stall, Tauben schwirrten ziellos durch die Luft, ausgebrochene Pferde rannten verstört durch die Gegend. Auch in unserem Garten standen plötzlich Kühe und Pferde, die trotz des Aufruhrs ringsum friedlich das Gras abfraßen. Gehörten die jetzt uns? In der Rodacher Innenstadt brannten mehrere Häuser, so das von Sattlermeister Max Vock in der Heldburger Straße und der Kindergarten auf dem Schlossplatz.
Am späten Nachmittag, als Fladts Scheune nur noch qualmte, kamen die Amerikaner in ununterbrochener Folge die Heldritter Straße heraufgefahren: Jeeps, Lastwagen, Panzerspähwagen, Panzer! Der kleine Junge von acht Jahren, der ich damals war, stand stundenlang am Gartenzaun, sein Kinn reichte gerade bis zu den Lattenspitzen, während sein Augen sich nicht sattsehen konnten an den fremden Soldaten mit weißer, brauner, schwarzer Hautfarbe, die in endloser Kolonne hinter Leuckarts Glanzgoldfabrik und hinter dem Häuschen von Alma Weber, der Großmutter meines Freundes Erhard Leicht, in die frisch bestellten Felder einbrachen und die grüne Saat niederwalzten, dort in der Abenddämmerung Rugby spielten und sich rechteckige Erdlöcher gruben, die sich mit Stroh auspolsterten, um darin zu schlafen. Unseren Garten hatten sie auch erobert: Sie rissen die morschen Zaunlatten ab, um sie als Feuerholz zu benutzen. Überall saßen sie unter den Bäumen, kochten Kaffee, schlugen Eier in Bratpfannen und stießen, Kaugummi im Mund wälzend, unverständliche Laute aus. Außerdem wollten sie unsere Hühner schlachten, die aber meine Mutter vorsorglich im Taubenschlag versteckt hatte. In einem Jeep saß ein Offizier und telefonierte mit Max Steitz, Rodachs zweitem Bürgermeister, um ihn zur kampflosen Übergabe der Stadt zu bewegen: „Rodach, surrender!“ (Rodach ergib dich!).
Unsere Hühner fingen sie nicht, wohl aber zwei SS-Offiziere, die sich, ohne dass wir es gewusst hätten, in einem Reisighaufen unter der Tanne versteckt hatten. Fast wären meine Mutter und meine Tante deshalb verhaftet und mitgenommen worden! Aber die Villa von Leuckarts gegenüber beschlagnahmten sie als Hauptquartier in Rodach und setzten die weinende Hilde Leuckart auf einem Stuhl vor das Gartentor in der Heldritter Straße, wo sie dann von ihrer Schwester Ilse Ritz vom Sägewerk in der Heldburger Straße abgeholt wurde.
Als es dunkel geworden war an diesem ersten Tag des Friedens, und meine beiden Schwestern Karla und Marei sowie Base Maren schon schliefen, sprach mich ein amerikanischer Soldat im Garten vor unserer Waschküche an und deutete auf zwei schwarze Kästen, die er mir schenken wollte. Es waren ein Grammofon mit einer Kurbel zum Aufziehen und eine Schallplattensammlung. Das hatten sie wohl irgendwo in Thüringen bei ihrem Siegeszug mitgenommen. Ich schleppte die beiden Kästen ins Wohnzimmer. Mutter und Tante schlossen die Fensterläden von innen, zogen die Fenster zu und die Vorhänge vor und begutachteten bei Kerzenlicht mein amerikanisches Geschenk. Jede Platte wurde einzeln geprüft: Die in Schellack gepressten „Führerreden“, die Platten mit den NS-Liedern und Märschen, die gestern noch die Herzen hatten höher schlagen lassen, wurden sofort zertrümmert. Das „Dritte Reich“ war schließlich, seitdem die Amerikaner im Garten standen, untergangen. Es konnte gefährlich sein, solche Erinnerungen aufzuheben, auch die Karte von „Großdeutschland“, die immer hinter der Küchentür an der Wand gehangen hatte, war über Nacht verschwunden. Abwechselnd lasen meine Mutter und meine Tante vor, welche Platten sie gleich vernichten würden: den „Badenweiler Marsch“, das „Horst-Wessel-Lied“ und das „Deutschlandlied“, das zuletzt und das besonders. Staunend und ratlos musste ich mit ansehen, wie mein amerikanisches Geschenk immer kleiner und kümmerlicher wurde. Behalten durfte ich den „Steinmetzmarsch“ und den „Finnischen Jägermarsch“. Auch die Operettenlieder, die ich in meinem Alter noch nicht verstand, durften bleiben.
Glücklich schlich ich in mein Bett. Ich war plötzlich reich geworden. Am nächsten Morgen wollte ich das alles meinem Freund Erhard Leicht im Dammüllersweg erzählen. Der würde staunen!
Am nächsten Morgen, Mittwoch, 11. April 1945, erwachte ich, weil schräg unter meinem Fenster im Taubenschlag der Hahn krähte. Ich sah verstohlen hinaus, es dämmerte schon, schlaftrunkene Amerikaner taumelten durch das taunasse Gras und sahen verwundert in die Höhe, wo der Hahn krähte. In allen Bäumen unseres weitläufigen Gartens veranstalteten die Vögel ein Freudenkonzert über das Kriegsende, und über der Veste Coburg ging die Sonne auf!