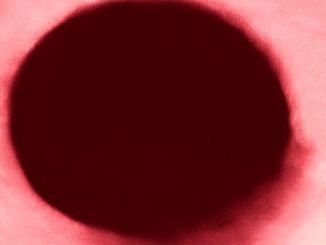Sergej Prokofjews Monumentalwerk „Krieg und Frieden“ (1943 ff.) klemmte Vladimir Jurowski, seit der Spielzeit 2021/22 GMD der Bayerischen Staatsoper, vom 14. bis 16. März 2023 zwischen zwei Aufführungen von Krzysztof Pendereckis „Die Teufel von Loudon“ (1969), zwei in München so gut wie unbekannte, bislang nie gespielte Opern der klassischen Moderne. Mit 50 Jahren ist „man“ noch Manns und ehrgeizig genug, ein derart dichtes Programm zu stemmen. Unter dem vehement schlüssigen, Sänger-freundlichen, hochkonzentrierten, leidenschaftlichen und feinfühligen Dirigat des gebürtigen Moskauers mit klarer Distanz zum Ukraine-Aggressor Wladimir Putin ging nicht ein Jota an Substanz beider komplexer, sein Publikum erst finden müssender, aufregender Musiktheaterwerke verloren. Beide Aufführungen wurden, trotz Überlänge der einen und heikler Thematik der anderen, einhellig heftig bejubelt. Das gerade sein 500jähriges Bestehen feiernde Bayerische Staatsorchester lief besonders bei „Krieg und Frieden“ zur Höchstform auf.
Diees an Lew Tolstois epochalen Roman von 1863-69 angelehnte Werk verlangte den gefühlt zweihundert bravourösen Musikern, Solisten, Choristen, Statisten, Tänzern, Kinderdarstellern die letzten Kraftreserven ab. Nicht weniger dem Publikum, das, im Gegensatz zur Generalprobe, schon bei der Premiere geschlossen durchhielt.
Jurowski einigte sich mit Regisseur und Bühnenarchitekt Dmitri Tcherniakov und Kostümbildnerin Elena Zaytseva auf einen Einheitsraum, die imposante Säulenhalle des geschichtsträchtigen Moskauer Hauses der Gewerkschaften und auf eine Fassung der Prokofjew-Oper, die, so Jurowski, „sich auf die Protagonisten Natascha Rostowa, Andrej Bolkonski und Pierre Besuchow konzentriert und in der das kriegerische Geschehen nur eine Kulisse bildet“.
Der mit der traurigen Liebesgeschichte Nataschas (bewegend und sonnig: Olga Kulchynska) und Andrejs (großartig: Andrei Zhilikhovsky) beginnende „Friedensteil“ – mit Längen, die man sich schon angesichts der Spieldauer von gut 4 Stunden hätte sparen können – ging ohne Striche durch. Der ins Groteske ausartende, erfindungsreich überspitzte, einen masochistischen glücklosen Angreifer Napoleon (Tómas Tómasson) wüten lassende, mit karikierend überdrehten Verfremdungen nervende „Kriegsteil“ büßte eines der insgesamt 13 „Bilder“ ein. Von Andrejs Sterbeszene wurde nichts gestrichen. So ließen sich „die ewigen Fragen stellen, die uns bis heute und vor allem heute wieder beschäftigen“ (Jurowski in Anspielung auf Russlands aktuell anhaltende Ukraine-Vernichtungen), ohne die mitzudenken aber die monströse, oft irritierende Schlachten-Szene nicht goutiert werden kann. Den patriotischen Schlusschor ersetzte man effektvoll durch ein 24 Mann starkes Blechbläser-Ensemble.
Aus der wohl längsten Besetzungsliste (darunter Größen wie Violeta Urmana, Sergei Leiferkus und der als Popanz-Feldmarschall Kurusow glänzende Dmitry Ulyanov) ragt eine Figur im 2. Teil heraus: der Zweifler und Pazifist, Sinnsucher und Sozialutopist Pierre Besuchow. Dem nicht hoch genug zu belobigenden armenischen Tenor Arsen Soghomonyan gelang gesanglich wie schauspielerisch die eindrucksvollste Charakter-Studie des Abends. In ihm finden sich beide großen Russen wieder: Tolstoi und Prokofjew.
***
Schon als 20-Jähriger dirigierte Vladimir Jurowski Krzysztof Pendereckis Oper „Die Teufel von Loudun“ in Dresden, zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele 2022 wagte er sich, 30 Jahre später, wieder daran, mit Simon Stone (Regie), Bob Cousins (Bühne), Mel Page (Kostüme) und Nick Schlieper (Licht) und dem Klangregler Sven Eckhoff. Für den Maiestro ist Pendereckis bewunderte Vertonung von Aldous Huxleys Text (1952), dessen Dramatisierung John Whitings Erich Fried 1968/69 ins Deutsche brachte, „eine Politsatire, ein schockierender Thriller und eine absurd-abstruse Liebesgeschichte mit Elementen eines erotischen Horrorfilms“.
Die von Stone genial in die Gegenwart versetzte packende, für viele gewiss verstörende wahre Geschichte von 1634 handelt von dem freizügigen, dem Zölibat zuwider handelnden Pfarrer Grandier der westfranzösischen Stadt Loudon. Er wird beschuldigt, mit dem Teufel im Bunde zu stehen und soll die Ursulinen verhext haben. Die Priorin Jeanne, die Grandier abgöttisch liebt, nein begehrt, aber abgewiesen wird, steigert sich in einen religiösen Wahn. Sie löst eine unsägliche Jagd auf einen Unschuldigen aus, der eine erstaunliche Veränderung seiner Lebenshaltung erfährt, bis er zum Opfer einer lüstern-verblödeten, sexual- und frauenfeindlichen Gesellschaft wird. Grandier wird, nachdem er sich gegen Kardinal Richelieu gestellt hatte, der Prozess gemacht, gefoltert und am Ende verbrannt.
Man kann sich der Stringenz dieser ohne Pause gut 2 Stunden dauernden Hetze auf einen zu Unrecht Verteufelten und grausam Abgeschlachteten, geradezu liebevoll getragen von Jurowskis perfekt durchgestyltem Dirigat, das Pendereckis brillante, zauberhafte Klangbilder gerierende Partitur bis ins Detail ausleuchtet, nicht entziehen. Es verschlägt einem immer wieder den Atem. Das liegt auch an der brutalen Optik, der man ausgesetzt ist, von der man noch lange nach der Aufführung leidend tagträumt: Stones/Cousins sich sachte und stetig drehender eiskalter Kloster/Kirchen/Rathaus-Würfel mit seinen Treppen und wechselnden Öffnungen gibt rücksichtslos die Wahrheit des Missbrauchs und der Intrige, des Exorzismus-Aberglaubens und der Massenhysterie, der Bigotterie und der Scheinheiligkeit preis.
Die Besetzung ist so farbig wie stimmig, überzeugend bis in die Nebenpartien nicht nur der lebenslustigen Nonnenschar, auch des Bürgermeisters (Mime Thiemo Strutzenberger) und des altgedienten Basses Martin Snell (Vater Ambrose). Dem den verkehrten Pfarrer ablehnenden Duo Apotheker/Chirurg geben Kevin Conners und Jochen Kupfer Sarkasmus satt, dem Beichtvater mit Gehstock gibt Ulrich Reß furchterregende Ambivalenz, dem königlichen Kommissar gibt Vincent Wolfsteiner tenorale Härte, die ins Mark sticht. Vater Barré, den man zur aufwühlenden Hauptszene, die Exorzismus-Konferenz, herbeiholte, verleiht Jens Larsens Bass Kleriker-Schrecklichkeit in Reinkultur. Der fabelhaften Danae Kontora gelingt es, als junges, geschwängertes Ding Philippe Mitleid zu erregen. Beide Hauptpartien sind mit der Litaurerin Ausrine Stundyte (Jeanne) und dem Amerikaner Nicholas Brownlee optimal besetzt. Jeanne zieht das Publikum von Anfang an in ihren Bann, sie macht stimmlich fulminant und darstellerisch konsequent die Figur zu dem, was letztlich auch ihr verachteter Angebeteter Grandier ist: eine Märtyrer-Gestalt. Brownlee enttäuscht höchstens seiner Beleibtheit wegen, die Partie gestaltet er, ein Nachfolger des ursprünglich vorgesehenen hauseigenen Wolfgang Koch, gesanglich mit Bravour.
Gratulation zur Auszeichnung als beste Aufführung durch „OPERA! AWARDS 2023“! In dieser „düsteren zeitgenössischen Oper um Politik, Glauben, Wahn und Irrsinn“ lenkten Stone und Cousins „den Blick messerscharf in das zeitlose Wesen der Geschichte“. Dirigent und Initiator Jurowski machte mit dem Bayerischen Staatsorchester die Musik Pendereckis „mit großer Lust am Klangexperiment zum Hörerlebnis“. Aus der „durchwegs überzeugenden Solistenriege“ rage Ausrine Studyte heraus.