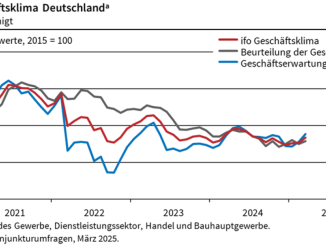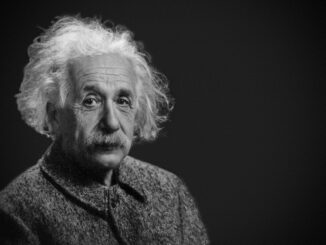EGON BAHR: Was nun? Ein Weg zur deutschen Einheit. Herausgegeben von Peter Brandt und Jörg Pache, Berlin (Suhrkamp) 2019, 222 Seiten
I.
Die staatliche Einheit Deutschlands erscheint anno 2019/2020 jüngeren Deutschen, vor allem den nach dem Mauerfall geborenen Altersgruppen, als eine Selbstverständlichkeit. Dass vor 1989 weder der Abbruch der Berliner Mauer noch die deutsche Wiedervereinigung vorhersehbar war, dass in der alten Bundesrepublik die ›deutsche Frage‹ als teils unlösbar, teils als obsolet abgehakt war, ist Jüngeren schwer zu vermitteln. Im (post-)nationalen Parteienstreit, in dem es um Themen wie das Klima, die Migration oder den Kampf gegen die AfD geht, spielen Fragen wie ›Wie war das vorher?‹ oder ›Wer gehörte in all den langen Jahren zuvor noch zu den Vorkämpfern der deutschen Einheit?‹ keine Rolle mehr.
Was sagt diesen Jüngeren, denen gerade noch Namen wie Adenauer, Kohl und Willy Brandt – sowie (meist nur im ›Osten‹) Ulbricht und Honecker – bekannt sind, der Name des 2015 verstorbenen Egon Bahr (siehe auch meinen Nachruf Der Realist und Patriot Egon Bahr (1922-2015))? Was erfahren Schulklassen heute im Geschichtsunterricht über Egon Bahr, den Mann, einst bekannt als der ›Architekt der Ostpolitik‹, und sein politisches Konzept?
Historischen Aufschluss vermittelt die vorliegende Schrift. Ihre Veröffentlichung verdankt sich dem Engagement Adelheid Bahrs, der Witwe Egon Bahrs, sowie dem Hagener Historiker und ältesten Sohn Willy Brandts, Peter Brandt. Es handelt sich um den Erstdruck eines 1965/66 von Bahr verfassten Manuskripts, das in dessen Nachlass bei der Friedrich-Ebert-Stiftung aufbewahrt wird. Die einstige Brisanz des Textes ist daran abzulesen, dass seinerzeit der Verleger Klaus Piper eine Publikation des Manuskripts ablehnte, da ihm – wie der Editorischen Notiz zu entnehmen – die »betont nationale Zielrichtung« der Abhandlung sowie deren »vermeintliche Verabsolutierung der Einheit gegenüber der Freiheit« nicht zusagte (S. 51). Auch Willy Brandt, der den Gedanken seines Vertrauten Bahr weithin zustimmte, hielt zu jenem Zeitpunkt – es war die Vorphase der von der ersten schweren Rezession überschatteten Großen Koalition – eine Veröffentlichung nicht für ratsam.
II.
Den historischen Kontext, in dem Bahrs Text zu lesen ist, erläutert Peter Brandt in seiner Einleitung. Er skizziert die Entwicklung der ›deutschen Frage‹ von der Potsdamer Konferenz (17. Juli – 2. August 1945), bei der die drei Siegermächte (ohne Teilnahme des indes für die Vier-Mächte-Verwaltung bereits kooptierten Frankreichs) noch von der Einheit des territorial erheblich reduzierten Deutschlands ausgingen. Dass die Einheit entgegen früher ins Spiel gebrachten Teilungsplänen erhalten blieb, war nicht zuletzt dem Interesse Stalins an sowjetischer Mitsprache über das Ruhrgebiet zu verdanken. Strittige Fragen wie die Form und Höhe der Reparationen sowie die künftige Ostgrenze sollten durch den in Aussicht gestellten Friedensvertrag behoben werden.
Zu einem formellen Friedensvertrag für Deutschland ist es nie gekommen. Der 2+4-Vertrag von 1990 (›Vertrag über die abschließenden Regelungen in Bezug auf Deutschland‹) ist somit nur als eine Art völkerrechtliches Substitut zu betrachten. Das Thema ›deutscher Friedensvertrag‹ spielte indes in der Nachkriegsära noch über Jahre hin eine Rolle, auch als die weltpolitische Entwicklung (1947/48) bereits in den Kalten Krieg gemündet hatte. Die Entzweiung der Siegermächte – mit einem ersten Höhepunkt in der Berlin-Krise 1948/49 – zog 1949 phasenverschoben die Gründung der beiden deutschen Nachkriegsstaaten nach sich. Selbst nach der Einbindung der beiden deutschen Staaten in die Militärblöcke Nato und Warschauer Pakt 1954/55 blieb die ›deutsche Frage‹ in den 1950er Jahren noch ein zentrales Thema der deutschen und internationalen Politik. Die Kontroversen über die ›verpasste Chance‹ durch die Zurückweisung der Stalin-Noten 1952, in der Einleitung nur gestreift (S. 12), erläutert Brandt in einer längeren Anmerkung zu Bahrs Text (S. 194f., Anm. 13). Der Blick ist auf die Deutschlandpolitik der SPD gerichtet, die – auch vor dem Hintergrund von militärischen, insbesondere nuklear-strategischen Disengagement-Konzepten wie des polnischen Rapacki-Plans (1956-59) – bis 1959 auf Neutralisierung und Wiedervereinigung Deutschlands zielte.
Nach der ergebnislosen letzten Viermächte-Konferenz in Genf im Sommer 1959, an der erstmals Vertreter der beiden deutschen Staaten am ›Katzentisch‹ teilgenommen hatten, sowie dem 1960 geplatzten Pariser Gipfeltreffen zwischen dem sowjetischen Parteichef Nikita Chruschtschow und US-Präsident Eisenhower war die ›deutsche Frage‹ auf Eis gelegt. Angesichts der sowjetischen Politik, die einen separaten Friedensvertrag mit der DDR ankündigte und dies mit der Forderung nach einem entmilitarisierten Sonderstatus für West-Berlin verknüpfte, zog die SPD 1960 ihren ›Deutschlandplan‹ vom Vorjahr aus der Diskussion.
Ein Jahr später, am 13. August 1961, war die deutsche Teilung für alle Welt sichtbar mit der Berliner Mauer befestigt worden. Im Oktober 1962 erreichte der Konflikt der beiden Supermächte – ein damals gerade etablierter Begriff – während der – auch für West-Berlin bedrohlichen – Kuba-Krise den in der Rückschau entscheidenden Höhepunkt. Vor einem heißen Krieg mit allen Risiken eines Atomkriegs schreckten die beiden Weltmächte zurück. Beide Seiten entschieden sich – von sowjetischer Seite bereits 1956 unter dem alten Leninschen Schlagwort ›friedliche Koexistenz‹ proklamiert – für einen bereits unter Eisenhower angestrebten Kurs der Entspannung, wenn auch im Wesentlichen beschränkt auf die Nuklearrüstung. Das Ausscheiden Frankreichs unter Präsident de Gaulle aus der militärischen Integration der Nato (1966) veränderte nur ansatzweise die Blockstruktur. Anders als von einer Minderheit von ›Gaullisten‹ befürwortet, verknüpfte die westdeutsche Politik unter Adenauers Nachfolger, dem ›Atlantiker‹ Ludwig Erhard (CDU), ihr Sicherheitskonzept weiterhin mit den Garantien der USA.
Die deutsche Teilung und die Suche nach deren Überwindung bewegte durchaus glaubwürdig noch die Herzen westdeutscher Politiker. Aber praktikable Wege standen angesichts des Arrangements der Weltmächte nicht offen. Mehr und mehr setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Wiedervereinigung nur noch in einem längeren Prozess erreicht werden könne, der jeweils von den Interessen der beiden Vormächte – letztlich von der Sowjetunion – bestimmt sei. Immerhin erkannten Politiker aus allen Parteien, unter ihnen der FDP-Vorsitzende und Minister für Gesamtdeutsche Fragen Erich Mende: »wenn die ›große Konzeption‹ nicht realisierbar erscheint, dann muß die Stufenpolitik der kleinen, mittleren und großen Schritte verfolgt werden: Ich sehe die Wiedervereinigung nur noch als einen Prozeß über Jahrzehnte an.« (S. 215, Anm. 88)
III.
Die mit der Mauer konfrontierten Berliner ›Ostpolitiker‹ – der unter Insidern als ›Heilige Familie‹ bekannte Zirkel um den Regierenden Bürgermeister Willy Brandt – suchten nach gangbaren Wegen aus der weltpolitischen Sackgasse. Wandel durch Annäherung hieß der Vortrag, den Egon Bahr am 15. Juli 1963 in der Evangelischen Akademie Tutzing hielt, in dem er erstmals öffentlich ein Konzept zur Überwindung des durch den Mauerbau fixierten Status quo in Berlin und Deutschland vorlegte. In mancherlei Hinsicht ist Was nun? – der Tutzinger Text erscheint hier noch einmal als Unterkapitel (S. 98-106) – als aktualisierte Vertiefung dieser früheren Überlegungen zu verstehen.
Bahr war zeitlebens Realpolitiker (was weder mit Hypermoral noch mit Amoral zu tun hat). In dem Kapitel »Bestandsaufnahme« liefert er eine zeitlos plausible Definition von Politik: »Denn was anders ist Politik als der Versuch, eigene Interessen gegenüber anderen Interessen durchzusetzen?« (S. 71) Was nun? Er fordert den Blick nach vorn zu richten, statt über »verpasste Chancen« nachzusinnen (en passant erwähnt er auf S. 69 die im Westen kaum bekannte, rein hypothetische Chance, die sich für die Deutschlandpolitik ergeben hätte, wenn die verbündeten Machthaber der Sowjetunion neun Monate nach Stalins Tod nicht dessen georgischen Intimus Lavrentij Pavlovič Berija (1899-1953) hätten erschießen lassen.) Ebenso fruchtlos sei es, unter den gegebenen Umständen, auf einen plötzlichen Positionswechsel seitens der Sowjetunion zu hoffen. Die in den 1950er Jahren vielfach propagierte »Politik der Stärke« habe sich als politisch fruchtlos erwiesen. Wolle man nicht in Stagnation verharren, sei eine »neue« Politik vonnöten.
Für Bahr war die Sowjetunion seinerzeit (1965/66) für Neutralisierungskonzepte nicht mehr zu haben. Sie hatte soeben (1964) durch einen auf zwanzig Jahre anberaumten Freundschaftsvertrag der DDR eine Existenzgarantie gegeben. An diesen Fakten habe sich deutsche Politik zu orientieren. Ein untätiges Verharren im Status quo, so Bahr, werde zu einer Entfremdung der Deutschen in den beiden Staaten und zur Vertiefung der Teilung der deutschen Nation führen. In zwanzig Jahren werde eine Vereinigung der Bundesrepublik mit der DDR schwieriger sein, »als Österreich und die Bundesrepublik zusammenzubringen.« (S. 67)
Bahrs Überlegungen zielten nach wie vor auf die – wenngleich nur noch stufenweise zu erreichende – Wiedervereinigung. Sein Konzept – er entwickelte einen 8-Stufen-Plan mit »kleinen« und »großen Schritten« über die vertiefte Kooperation hin zu einem von beiden deutschen Staaten anzustrebenden Friedensvertrag und zur staatlichen Wiedervereinigung – hatte vornehmlich zwei Adressaten: die Sowjetunion und die DDR. Hinsichtlich der – als nicht mehr expansiv betrachteten – Sowjetunion setzte er auf deren »Interesse an einem Frieden, der sicherer ist als heute, mit einem befriedeten, ohne territoriale Ansprüche vereinten Siebzig-Millionen-Volk in der Mitte Europas.« (S. 72) Die Prämisse war, dass es ein plausibles Sicherheitsinteresse der Sowjetunion gebe, welches durch einen realen Friedenszustand besser gewährleistet sei als durch die Behauptung ihres militärischen Glacis. Die über eine deutsche Initiative anzustrebenden Verhandlungen zwischen den Siegermächten und deutschen Vertretern aus beiden Staaten sollten ein europäisches Sicherheitssystem etablieren. In dessen Rahmen sei der Abzug der sowjetischen Truppen aus der DDR möglich, denkbar indes nur, »wenn nicht auch westliche Truppen abziehen.« (S. 143)
An der sich nach dem Mauerbau in den 1960er Jahren auch ökonomisch stabilisierenden DDR führte kein Weg mehr vorbei. Alles andere als ein fellow traveller – Peter Brandt stellt ihn als Bewunderer Kurt Schumachers vor –, ging Bahr vom patriotischen Bewusstsein der Kommunisten in der DDR aus (»Gesucht: Patriotische Kommunisten«, S. 77-78) und von der – in den Jahren nach den Mauerbau ökonomisch und politisch immerhin ansatzweise erkennbar – »wachsenden Selbständigkeit der DDR« (S. 80-84). Die vom SED-Chef Walter Ulbricht noch in den 1960er Jahren propagierte Konföderation zweier (vermeintlich) ›souveräner‹ und selbstständiger Staaten lehnte Bahr seinerzeit ab. Eine staatliche Anerkennung ohne vertragliche Vereinbarungen in Richtung Einheit werde es nicht geben. Entsprechend wären Konzessionen an die DDR-Kommunisten – etwa durch Verzicht auf Eigentumsansprüche – nur sinnvoll, wenn am Ende wieder ein geeinter deutscher Nationalstaat stehe.
IV.
Die Geschichte ist offenbar über das vor fünfundfünfzig Jahren entwickelte, unter Verschluss gehaltene Konzept des Ostpolitikers Bahr hinweggegangen. Nichtsdestoweniger werden Historiker in der 1970-1973 von Willy Brandt und Egon Bahr verfolgten Vertragspolitik mit Moskau, Warschau (sowie Prag) und im ›Grundlagenvertrag‹ von 1972 mit der DDR Elemente des wenige Jahre zuvor konzipierten Entwurfs wiederfinden. Der Streit darüber, welche Bedeutung der damaligen ›Ostpolitik‹ im Blick auf den zwanzig Jahr später erfolgten – noch anno 1989 unvorhersehbaren – Mauerfall und die Wiedervereinigung zukommt, ist längst abgeebbt. Dass die menschlichen, kulturellen und politischen Fäden zwischen den beiden ›Deutschlands‹ nicht gänzlich durchtrennt wurden, war das historische Verdienst von Bahr und Brandt.
Bahr dachte und handelte als deutscher Patriot – heute ein zeittypisch verdächtiger Begriff. Sein Text enthält Formulierungen, die ihm heute den Ruf eines ›Nationalisten‹ eintrügen, zumal wenn er geschichtsbewusst, aber eben ohne Tremolo von der in einem Friedensprozess (bzw. Friedensvertrag) noch zu begleichenden Schuld an dem von Hitler-Deutschland verursachten und verlorenen Krieg sprach.
Bahrs Konzept der Überwindung des Status quo durch dessen Anerkennung stieß bereits Ende der 1970er Jahre bei dem ungestüm patriotischen Rudi Dutschke auf Widerspruch. In den 1980er Jahren – in der DDR zeichneten sich bereits neue, für das Regime ›subversive‹ Tendenzen ab – schien Bahr in seinen auf ›Gleichberechtigung‹ der DDR gegründeten Aussagen das Einheitsziel aufgegeben zu haben. Dass dies nicht der Fall war, betont sein jüngerer Freund Peter Brandt – auch unter Hinweis auf Bahrs 1988 veröffentlichte Schrift Zum europäischen Frieden. Eine Antwort auf Gorbatschow.
Das hier vorgestellte Buch dürfte in seiner Wirksamkeit auf die historische Fachwelt beschränkt bleiben. Das ist schade. Es könnte Jüngeren ein nüchterneres, schärferes Bild der deutschen Realgeschichte vermitteln. Dazu könnte fraglos neben Peter Brandts Einleitung der detaillierte Anmerkungsapparat beitragen. Dazu jedoch eine kritische Notiz: Bezüglich des Themas ›deutsche Verluste durch Vertreibung‹ folgt der Herausgeber dem Militärhistoriker Rüdiger Overmans, der (1994) von ca. 600 000 Toten durch Flucht und Vertreibung ausgeht. (S. 209f., Anm. 61) Hingegen erklärte 2004 der amerikanische Historiker Norman M. Naimark vor der Historischen Kommission der SPD: »Im Fall der Vertreibung der Deutschen ist es schwer zu bestimmen, wie viele Menschen in welcher Phase der Deportationen starben. Manche starben noch in den Auffanglagern. Die Schätzung von insgesamt zwei Millionen Toten scheint nicht übertrieben« (s. N. M. Naimark: Strategische Argumente, in: FAZ vom 21. Januar 2004).
Zum Schluss ein Desideratum: Ein Register, das einem breiteren Publikum den Zugang zu diesem wichtigen Zeitdokument erleichtert hätte, wäre wünschenswert gewesen. Ans Herz gelegt sei den Lesern im Blick auf die heutigen Weltläufe und deren Akteure eines der beiden Motti, die Bahr seiner Schrift voranstellte: »Alle großen Taten und alle großen Gedanken haben in ihren Anfängen etwas Lächerliches.« Es stammt von Albert Camus.
Quelle: Iablis