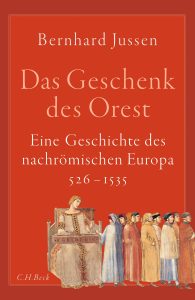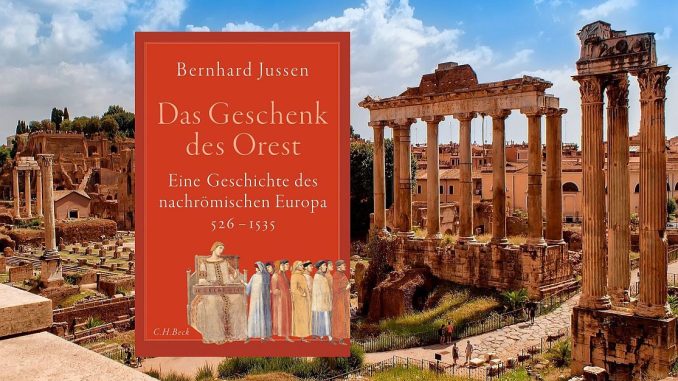
Bernhard Jussen: „Das Geschenk des Orest“. Eine Geschichte des nachrömischen Europa 526 – 1535, C.H. Beck, München 2023. 480 S., viele Abb., geb., Fadenheftung, Lesefaden, 44 Euro.
Die Epoche, die heute als Frühmittelalter bekannt ist, hat nur wenige Kulturzeugnisse hinterlassen – es ist ein Bruchteil dessen, was davor die Römer und danach die Künstler der Renaissance zustande brachten. Aus dem frühen Mittelalter, kulturell gesehen ist es ja eigentlich eine „vergehende Antike“, kommen zudem fast ausnahmslos Artefakte, die insgesamt von drastisch sinkenden Fähigkeiten der Künstler zeugen. Doch halt! Es sei die provokante Frage gestellt, ob dieses Frühmittelalter, das als „finstere“ Epoche verkauft wird, nicht vielleicht von den Zeitgenossen ganz anders empfunden wurde – höchst amüsant, unbeschwert und geradezu paradiesisch.
Ja, wie kommt man auf diesen Gedanken? Beim Blick in den heutigen Alltag. Speziell beim Anblick mehrheitlich junger Menschen mit Mobiltelefonen. Sinken unsere gesamten kognitiven Fähigkeiten, durchschnittlich betrachtet, nicht derzeit rapide? Der mobile Alleskönner aus Hartplastik, etwas Glas, gefüllt mit seltenen Erden, nimmt uns alles ab – von der Orientierung in der Umwelt bis zur Merkfähigkeit für Termine und Formeln oder Telefonnummern bis hin zu den einfachsten Rechenschritten. Und dann blicken sie ausnahmsweise auf, die jungen Leute, und die leeren Blicke treffen auf „Kunst am Bau“. Ja, auch unsere Gegenwartskunst ist nicht unbedingt vom „Können“ her definiert. Dann schauen sie nach links, nach rechts. Wo ist der große Horizont? Moment bitte – „großer Horizont“? Ach, vergessen sie’s, liebe gegenderte, woke, vegane Leser*schaft, genießen Sie die Katzenbilder im Handy.
Was inspiriert zu derlei Gedankenspielen? Ein neues Werk von Bernhard Jussen, „Das Geschenk des Orest“. Dieses Buch betitelt der Autor selbst ganz am Rande – in seinen Danksagungen –, als „opus magnum“. Und wieso? Er möchte bei der Beurteilung der großen Menschheitsepochen nichts weniger als „die Gewichtung herumdrehen“, bei der Antike, dem Mittelalter, der frühen Renaissance. So kündigt er es auf Seite 19 an. Oha, das ist eine ganze Menge Holz, das er da zu hacken gedenkt. Und wird Jussen diesem selbstgesteckten Anspruch gerecht? Wir kommen darauf zurück.
Wenden wir uns dem Inhalt dieses schon äußerlich prachtvollen und insgesamt gewichtigen Buches zu. Da ist zuerst die Idee, im Totengedenken für eine Witwe, wir reden über das frühe 6. Jahrhundert nach Christus, die Wandlung hin zu einer neuen Gesellschaft zu erkennen und zu formulieren. Das gelingt schlüssig, das ist genial. Die Frau wird als „Turtura“, als Turteltaube also, bezeichnet, sie heiratete nach dem frühen Tod ihres Manes nicht wieder; ihr Bildnis befindet sich in der spätantiken römischen Katakombe Commodilla. Nicht weniger beeindruckend ist das kulturelle Gegenstück, eine Elfenbeintafel des vorletzten römischen Konsuls Orest. Der Autor versteht es, die ikonographische Botschaft dieser Tafel als ebenso aussagekräftiges Indiz für ebendiesen Wandel einzuordnen – und sie zugleich zur Titelgebung für sein Buch zu verwenden.
Zweifelsohne beschreibt Jussen eine Epoche voller starker Wandlungen, und er tut das virtuos. Wie stark der Wandel indes wirkte und wirkt, extemporiert er am Beispiel des Islam. In der FAZ kritisiert ihn dafür Andreas Kilb: „Ein zentraler Punkt, mit dem Jussen seine Studie an die Probleme der Gegenwart anzuschließen versucht, ist die Behauptung, die lateinische und orthodoxe Kirche und der Islam hätten jeweils ‚zu sehr verschiedenen Gesellschaften’ geführt.“ Kilb möchte das als herbe Kritik verstanden wissen, wir aber stimmen Jussen lebhaft zu. Hier hat er Recht! In einem späteren Beitrag für Tabula Rasa zu diesem Buch wollen wir darauf zurückkommen, wie tiefgreifend die Unterschiede der Gesellschaften sind, die sich einerseits aus dem christlich-jüdischen, andererseits aus dem moslemischen Kontext speisen. Und wie überzeugend der Autor dies begründet.
Aber zuvörderst geht es ja um eine Besprechung, geht es um Jussens „Geschichte des nachrömischen Europa“. Schon auf Seite 11, in der Einleitung, stellt er eine Hypothese auf: „Wer keinen epochalen ‚Untergang’ um 500 mehr sieht, der wird wohl auch keinen ebenso epochalen Wiederaufstieg zu alter Größe durch brillante Humanisten und Konfessionskämpfer um 1500 mehr suchen oder finden können.“ Dazu passt recht gut, dass er selbst sagt – auf Seite 361 –, dass um das Jahr 1000 herum die entscheidende kulturelle Aufbauarbeit in Europa bereits getan war. Zustimmung, so war’s! Das mit der Abwesenheit des epochalen Unterganges verstehen wir nun. Es war ein epochaler Umbau, es gab keinen Untergang. D’accord!
Doch dann kommen Einwände, denn wir sehen auch, daß mit der Wiederentdeckung der Algebra und der in der Antike gefundenen Maße die Baukunst ab dem 13. Jahrhundert gründlich revolutioniert werden konnte – zuerst war es die Gotik, später entstand als eigenständiger Stil, direkt auf die Spätantike hinweisend, die Renaissance. Könnte es also sein, daß es um 1500 herum ohne vorherigen Absturz einen epochalen Aufstieg gab? Kein „Wiederaufstieg zu alter Größe“, sondern abermals ein Umbau zu einer „völlig neuen“ Größe? Hier bleibt bei Jussen ein immenser Interpretationsspielraum –die Lektüre des Buches wird aber umso spannender.
Im Jahr 1535 lässt Jussen sein Werk enden. Die Begründung dafür ist, dass in jenem Jahr die erste englischsprachige Bibel erschien, ohne päpstliche Genehmigung, ein Zeichen für den Geist der Reformation, der nun ganz Europa erfasst hatte, indem Heinrich VIII., König von England, um einer Ehescheidung willen den Bruch mit Rom vollzog. Womit sich theoretischen der Bogen spannen lassen müsste zwischen jener spätantiken „Turtura“ in ihrer Katakombe Commodilla und Katharina von Aragon, von der der virile Heinrich VIII. sich lossagte. Nun, das scheint dann doch ein wenig konstruiert; wäre nicht auch das Erscheinen von Luthers 42zeiliger Bibel, gedruckt bei Johannes Gutenberg zwischen 1452 und 1454, ein passendes Datum gewesen? Immerhin ist quasi gleichzeitig, 1453, mit der Eroberung Konstantinopels durch moslemische Ottomanen der Untergang des letzten Römischen Reiches zu beklagen. Vielleicht wählte Jussen das spätere Datum, weil dann das Jahrtausend voll wurde? Wir erinnern uns – es soll ein „opus magnum“ sein.
Was nach alledem bleibt, ist weiterhin die Vermutung, daß das „finstere“ Mittelalter gar nicht finster war, sondern ganz im Gegenteil sehr unbeschwert, hell und hedonistisch. Zumindest für die Wohlhabenden, denen es damals gar nicht mehr wichtig war, irgendetwas für eine längere Zukunft zu konservieren. Wer wissen möchte, was damit gemeint ist, schaue sich seine Sprösslinge an, wenn sie mit ihren Mobiltelefonen kommunizieren – per Snapshat, denn Instagram ist out, Twitter ist X, E-Mail ist Boomer. Ein neues geistiges Frühmittelalter? Das Buch von Bernhard Jussen ist speziell vor diesem Hintergrund empfehlenswert – und wer partout nicht weiß, was hier gemeint sein könnte, der dokumentiert nur umso besser, wie richtig die Botschaft ist, die wir diesem Buch entnehmen konnten.
Bleibt noch die Frage, ob es gelang, die Epochen der europäischen Geschichte komplett neu zu definieren, „die Gewichtung herumzudrehen“. Nein, eher nicht; aber es wäre auch wirklich etwas zuviel verlangt gewesen. Zudem ist die Denkrichtung des Autors eventuell doch etwas weniger neu, als er selbst es angekündigt hatte. Wenn wir das Buch trotzdem wärmstens empfehlen, dann deswegen, weil es auf ganz andere Weise wirklich ein „opus magnum“ ist. Das liegt an der Fülle von Anregungen, über die sich auch länger nachzudenken sehr lohnt, es liegt am auch Reichtum der dargebrachten Quellen – kurzum, an einer großartigen tour d’horizon. Sehr hoch ist es zu bewerten, dass hier ein höchst lesenswertes, überdurchschnittlich schön gestaltetes, liebevoll illustriertes und insgesamt mit viel Herzblut produziertes Buch entstanden ist. Um diesem Werk gerecht zu werden, müsste aber die allwissende Müllhalde heutiger Tage, das Mobiltelefon, zur Seite gelegt, müsste das brandneue und hochwichtige Katzenvideo für einige Zeit ignoriert werden.