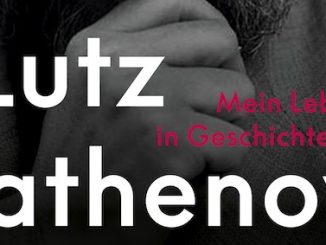Steffen Mau: Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt (edition suhrkamp), Berlin: Suhrkamp-Verlag 2024, 168 Seiten, Paperback, 18 Euro
„Eine kleine politische Schrift zu Gesellschaft, Politik und Demokratie“ in Ostdeutschland hat der Berliner Soziologe Steffen Mau vorgelegt. Sie vereint drei unterschiedliche Themen: Zum einen fasst Mau den Stand der Forschung zu fortbestehenden und seines Erachtens bleibenden Unterschieden in den drei genannten Bereichen zwischen West- und Ostdeutschland und ihren Ursachen zusammen. In dem Zusammenhang setzt er sich kritisch mit der populären Position des Leipziger Literaturwissenschaftlers Dirk Oschmann auseinander, der Osten sei eine Konstruktion des Westens. Zweitens schildert Mau Unterschiede in der politischen Kultur, die er letztlich für demokratiegefährdend hält. Schließlich wirbt er dafür, fokussiert auf Bürgerräte, den Osten Deutschlands zu einem „Labor der Partizipation“ zu entwickeln um die von ihm ausgemachte Distanz zwischen der Bevölkerung und den politischen Eliten zu verkleinern. Die Interpretationen des Verfassers zur aktuellen Lage stoßen auf eine recht breite Resonanz und verdienen schon daher Aufmerksamkeit.
Dass „Sozialstruktur und Mentalitäten“ in den ostdeutschen Ländern durch das Leben in der DDR vor 1989/90 und durch die einschneidenden Erfahrungen der Transformation geprägt worden sind, ist heute weitgehend Konsens. Mau breitet ihn kenntnisreich und gut lesbar aus. Wesentliche Stichpunkte sind im Bereich der Sozialstruktur die „Vermögensmauer“ zwischen Ost und West, die „dramatische Elitenschwäche“, also der Mangel an Ostdeutschen in Führungspositionen selbst in Ostdeutschland, und das schwächer ausgeprägte „bürgerschaftliche Engagement“. Zu Recht verweist er auf die Demographie. Der Osten leide unter Abwanderung, Geburtendefizit, Überalterung und einem regional konzentrierten Männerüberschuss, da mehr Frauen als Männer abgewandert sind. Auf vergleichbar harte Fakten kann Mau beim Blick auf den „eigenständigen Kultur- und Deutungsraum Ostdeutschland“ nicht verweisen. Deutungsunterschiede beim Blick auf die DDR, die Transformation und politische Fragen wie den Krieg Russlands gegen die Ukraine oder den Klimawandel lassen sich jedoch demoskopisch gut nachweisen. Hinzu komme eine „Verlustaversion“ vor dem Hintergrund erlebter biographischer Brüche.
Spannend wird es bei der Ursachenforschung. In der Volkskammerwahl vom März 1990, einem klaren Votum für eine schnelle Wiedervereinigung, sieht Mau „weniger eine politische Willensbekundung in der DDR als vielmehr eine gegen die DDR“. Man könne den Schritt zur Wiedervereinigung als „Selbstentmachtung in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Selbstermächtigung im Herbst 1989“ interpretieren, mit Folgen für das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit. Die „Selbstwirksamkeitserfahrung“ hätte man jedoch gebraucht, „um die Demokratie mit Leben zu füllen“. Das demokratische Potential sei unternutzt, das nationale übernutzt worden. Mit Letzterem fremdelt er. An anderer Stelle wundert er sich über „einen fast ethnisch verstandenen Zusammengehörigkeitsglauben“, während sich doch in den Jahren der Teilung „zwei unterschiedliche Gesellschaften“ herausgebildet hätten.
In Maus Duktus könnte man sagen, dass er die gesellschaftliche Dimension überschätzt und die nationale unterschätzt. Auf die deutsche Einheit zu setzen, statt einen ungeliebten Teilstaat auszugestalten und über dritte Wege nachzusinnen, war ein höchst selbstwirksamer Akt. Worin ein „über den Herbst 1989 hinausweisendes emanzipatorisches Projekt mit eigenen Begriffen, Bewusstseinsformen und politischen Zielen“ hätte bestehen sollen, bleibt völlig schleierhaft. Der Verfasser übersieht zudem, dass in den Kommunen und den neuen Ländern Gestaltungsräume entstanden und man etwa in den Beratungen über die Landesverfassungen intensiv über die Ordnung von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft stritt. Gleichwohl, und hier ist Mau recht zu geben, war ein Rahmen abgesteckt, und die insoweit auf „Nachahmung angelegte Transformation“ hatte auch Nachteile. Etwa den beträchtlichen Transfer von Funktionseliten, die alsbald nach dem eingeübten Muster „Die da oben, wir hier unten“ kritisiert worden seien.
Gut beobachtet ist auch, wie schwer sich Parteien im Osten anfangs taten. Mau verweist auf die SED und die anderen Blockparteien als historischen Ballast aus der DDR, die „straßendemokratische Emanzipationserfahrung“ (Christina Morina) als „demokratische Urerfahrung der Ostdeutschen“ und den „eher präsidentiellen Politikstil“ der Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (Brandenburg), Kurt Biedenkopf (Sachsen) und Bernhard Vogel (Thüringen) in den 1990er Jahren. Als Mitgliedschaftsorganisationen seien die Parteien bis heute nicht wirklich bedeutsam. Überzeugen kann der Sozialwissenschaftler auch mit seinen Anmerkungen zu der aus seiner Sicht bisher unzulänglichen „Aufarbeitung der DDR-Diktatur“ – besser spräche er allerdings von einer SED-Diktatur in der DDR. Sie krankt seines Erachtens vor allem daran, dass sie von ostdeutschen Bürgerrechtlern und Westdeutschen am Empfinden und den Erfahrungen der großen Mehrheit der Ostdeutschen vorbei betrieben worden sei und als Belehrung empfunden werde. Mau zitiert zustimmend den Historiker Ilko Sascha Kowalczuk: „Aufarbeitung muss die Menschen dort abholen, wo sie stehen; nicht wo die Aufarbeiter stehen.“ Ein undifferenziertes Bild habe in den Familien tradierte Gegenerinnerungen freigesetzt, die Mau keineswegs gutheißt. Autoren wie Oschmann oder der Historikerin Katja Hoyer hält er vor, „Mentalpflegetexte“ verfasst zu haben, die Alltagsgefühle lediglich bestätige, statt die Leser zu fordern.
Verdichtet sich all dies zu einer ostdeutschen „Identität“? Mau verbindet sein grundsätzliches Ja mit vielen Abers. Es gebe „den Osten als spezifischen Erfahrungs-, Sozial- und Kulturraum, der als subjektiv erlebter und gedeuteter kollektiver Zusammenhang zum Thema wird“. Ostdeutsche Identität sei bei den allermeisten jedoch nur „eine Identitätsfacette unter anderen“ – man ist auch etwa Sachse, Deutscher und Europäer und nicht nur Ostdeutscher –, keinesfalls eine „Abgrenzungsidentität“, „eine Erfahrungsschicht neben anderen“, und als „Ostbewusstsein“ (Valerie Schöninan) gebe es sie ausdrücklich nur im Plural. Was „der Osten“ für Mau jedenfalls nicht ist: eine „westdeutsche Erfindung“ (Oschmann). Gestützt auf eigene Forschungen, hält Mau dem entgegen, Westdeutsche sähen in Ostdeutschen keineswegs vor allem „die Anderen“, die sie identitätspolitische interpretierten, sondern Ostdeutsche sähen sich selbst so. Mit höchst unterschiedlichen Folgen. Er umreißt das Spektrum unter Verweis auf die Selbstthematisierung des Ostens durch ostdeutsche Nachwendeautoren einerseits bis hin zu Versuchen andererseits, über den Osten als eine Art Gegenwesten – „Der Westen ist so, wie man nicht werden möchte“ – politische zu mobilisieren.
In den folgenden Kapiteln – „Politische Konfliktlagen“ und „Allmählichkeitsschäden der Demokratie“ – wird der Essay zur Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus und der im Osten stärkeren AfD, die der PDS beziehungsweise der LINKEN den Rang „in Sachen ostdeutscher Identitätspolitik“ abgelaufen habe. Einige von Maus Thesen in diesen Teilen verdienten eine gründliche und vor allem kritische Diskussion. So tragen die für eine „Parteienpolitikverdrossenheit“ oder „Entparteipolitisierung“ vorgetragenen Argumente nicht sonderlich weit, wenn sich der Protest, das Ressentiment oder was auch immer auch im Aufstieg einer neuen Partei äußert; denn nichts Anderes ist, bei allen nachvollziehbaren politischen Vorbehalten, die AfD. Die Auseinandersetzung mit den in etlichen Absätzen um wissenschaftliche Distanz kaum bemühten Positionen soll und kann hier nicht geführt werden. Für die Pointe in Maus Abhandlung sind zwei seiner Beobachtungen entscheidend: Es gibt, und hier wird man zustimmen können, „im Osten aus strukturellen und historischen Gründen nur ein recht schwaches Band zwischen Regierenden und den Regierten“. Zum anderen sieht er bei allen Strategien zum Umgang mit der, genauer: gegen die AfD erhebliche Risiken und Nebenwirkungen; im ostdeutschen Kontext mehr noch als generell. Ein „Weiter so“ könne es nicht geben.
Mau schlägt daher vor, die eingefahrenen Gleise zu verlassen, die „andauernde Zweiheit in der Einheit“ zu akzeptieren und den Osten zum „Labor der Partizipation“ zu machen. In der Hoffnung, die sich nicht gehört und einbezogen fühlenden Bürger damit zu involvieren und Polarisierung zu überwinden. Es geht ihm darum, „die Gesellschaft enger mit der Politik zu verbinden und Entscheidungs- und Partizipationsmöglichkeiten jenseits der klassischen Parteien zu vergrößern“. Der Sozialwissenschaftler schlägt vor, über Losverfahren themenbezogene Bürgerräte zu bilden und die über Wahlen übliche Willensbekundung so durch Prozesse der Willensbildung zu ergänzen. Er argumentiert, auch hier gestützt auf eigene Forschungen, im moderierten, gleichberechtigten Gespräch würden sich radikale Positionen einhegen lassen. Zudem biete sich die Chance, die eigenen „Blasen“ zu verlassen „und sich mit anderen Weltsichten zu konfrontieren“.
Es gibt zwei zentrale Einwände gegen entsprechende Modelle aus gegensätzlichen Perspektiven: Die eine Seite warnt davor, in Bürgerräten bloße Alibiveranstaltungen ohne politische Konsequenzen zu sehen. Sind sie das jedoch nicht, schwächen sie, so die Gegenseite, die repräsentative Parteiendemokratie – die laut Mau im Osten ja ohnehin schon schwächer entwickelt ist. Er kennt diese Argumente und diskutiert sie breit. Wiederholt betont er, dass es ihm, anders als Vertretern radikaler Demokratietheorien, lediglich um eine Ergänzung des bestehenden Systems gehe. Wie sich dies institutionell umsetzen ließe, deutet er mit der Idee einer „dritten Kammer“ aus Vertretern des Bundestages, des Bundesrates per Los bestimmten Bürgern nur an. Kein besonders naheliegendes Beispiel, bedenkt man, dass er vor allem im Osten Handlungsbedarf sieht. Elegantere Versuche auf kommunaler oder Landesebene böten sich da eher an.
Insgesamt hat Mau eine in weiten Teilen gut beobachtende und zustimmungsfähige, in anderen zum Widerspruch herausfordernde, doch immer anregungsreiche Schrift vorgelegt, die zu Recht viel Aufmerksamkeit gefunden hat.