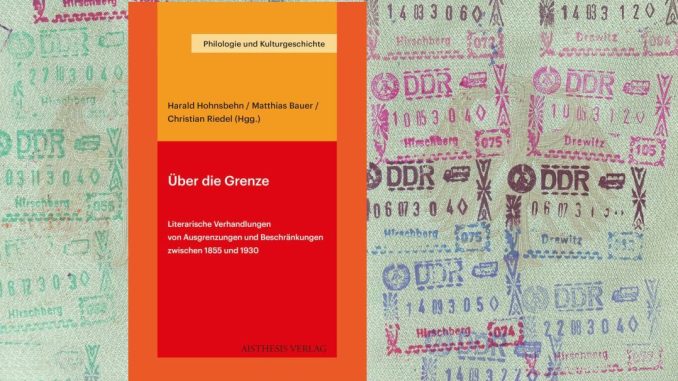
Es geht um Literatur. Kurz und knapp „Über die Grenze“ lautet der Titel, unter dem recht unterschiedliche Phänomene der gewollten und ungewollten Neuformierung durch Grenzziehungen ganz unterschiedlicher Art beobachtet werden. Der Aisthesis-Verlag hat diesen Band vorgelegt. Behandelt werden Texte aus dem Realismus und der klassischen Moderne, der Zeitrahmen reicht von 1855 bis 1930. Sechs von neun enthaltenen Beiträgen sowie eine angehängte Miszelle seien hier diskutiert.
Der Mitherausgeber Matthias Beuer eröffnet „Über die Grenze“ mit einer Studie zu Theodor Storm, Theodor Fontane und Gottfried Keller. Bezüglich des bearbeiteten – preußischen – Genres arbeitet er sich aber etwas am Begriff des „Junkers“ ab, was ein bisschen den altertümlichem Klassenkampf anklingen lässt. Was bei ihm als „Obrigkeit“ bezeichnet wird, ist aber doch wohl eher der staatliche Rahmen, der damals wie heute gegeben sein muss, wenn relative Gerechtigkeit – diese zumindest – herrschen soll. Den Begriff der Grenze verwendet er dabei sehr unscharf, sehr wenig fassbar. Das sei deswegen erwähnt, weil es sich durch den ganzen vorliegenden Band zieht, ganz wie der sprichwörtliche Rote Faden.
Julia-Karin Patrut überschreibt ihren Aufsatz knapp mit „Grenzarbeit“. Es geht bei ihr um das Phänomen der Grenzüberschreitung bei Wilhelm Raabe, genauer um seine Novelle „Sankt Thomas“, wobei der thematische Rahmen der Freiheitskampf der Niederländer gegen die Spanier ist. Den Atlantik erfährt der Leser als distanzgebendes Element, die menschliche Unterschiedlichkeit als gesellschaftliche Schranke. Die Autorin arbeitet die Relativität des Begriffs einer „Befreiung“ heraus, die sich dadurch ergibt, dass Grenzen unterschiedlich wahrgenommen werden, je nachdem, welcher standpunkt eingenommen wird.
Johanna Villebois beschäftigt sich ausführlich mit der Figur des Ceretto Meyer, ebenfalls erschaffen von Wilhelm Raabe, und zwar als Nebenfigur in seiner Erzählung „Meister Autor oder Die Geschichten vom versunkenen Garten“. Villebois stellt die Theorie auf, die Schwärze der Hautfarbe, die Cerettos äußeres Erkennungsmerkmal innerhalb des geschilderten Kontextes ist, sei konstruiert. Der Umgang mit Ceretto und die Rezeption seiner Andersartigkeit geschehe ausschließlich in den Köpfen der mit Ceretto handelnden Personen beziehungsweise im Kopf des Lesers. Abgesehen davon, dass hier eine wissenschaftlich korrekte Spurensuche betrieben wird, ist dieser Aufsatz ein Lehrbeispiel. Anstatt einer Hautfarbe könnte schließlich auch ein bestimmtes Geschlecht als „konstruiert“ postuliert werden. Womit wir mitten in einer hochaktuellen Debatte sind. Ob die Autorin indessen belegen kann, dass Wilhelm Raabes Ceretto eine bestimmte Hautfarbe eben nicht habe – das dar füglich bezweifelt werden. Letztlich dekonstruiert sich dieser Aufsatz selbst – durch seine offenkundige Bemühtheit.
Ganz anders – und souverän – Harald Hohnsbehn. Er nimmt das Werk Eduard von Keyserling in Augenschein. Besonders interessieren ihn die „Schlossgeschichten“, die thematisch im Osten Deutschlands angesiedelt sind, aber im Münchner Bohème-Stadtteil Schwabing verfasst wurden. Beginnend mit einer tour d’Horizon über Rezensionen und generell bei Zeitgenossen gelangt er zum Thema seiner Ausarbeitung, der zwischenmenschlichen Grenzen und Brüche. Diese Untersuchung wendet er dann auch auf den Keyserling-Roman „Fürstinnen“ an, um dies in „Abendliche Häuser“ auf die wohl absolute Grenze – den Tod – zu extrapolieren. Realtiv hingegen sind und bleiben die gelegentlichen Anmutungen sexuell aufgeladener Darstellung bei Keyserling, die der Autor weder verschweigt noch überbetont. Hohnsbehn konstatiert erstaunlich klare Pointierungen trotz insgesamt leiser Töne bei Keyserling. Insgesamt ist dies eine wohlwollende, hinführende Erläuterung zu einem Autor, der allen Liebhabern guter Literatur, die Keyserling noch nicht für sich entdeckt haben, durchaus Lust auf diese Lektüre macht. Einen erholsam „normalen“ Aufsatz hat der leider bereits verstorbene Mitherausgeber Hohnbehn geliefert, der sogar Initiator des vorliegenden Bandes war; in der Einleitung wird er – zurecht – posthum gewürdigt.
Robert Langhanke ermisst einen im 19. Jahrhundert politisch sehr stark grenzgeprägten Raum – Schleswig-Holstein, gelegen an der Grenze nach Skandinavien, teils noch dänisch regiert, aber im 19. Jahrhundert zunehmend unter dem Einfluss Hamburgs. Der Grenzerfahrung, die diesem Land den Stempel aufdrückt, stellt er die Grenzziehung, die Identitätsfindung gegenüber. Der Diplomat Christoph Jessen konkretisiert diese Beobachtungen in einer kurzen Miszelle am Schluß des Bandes mit Hinweisen unter anderem auf den Schleswig-Holstein-Krieg des Jahres 1864, der Entscheidungen brachte, Grenze auflöste und neue Grenzen entstehen ließ, die der Auto wiederum in Bezug zur Zeit des Kalten Krieges in Europa setzt. Interessant! Hier hätte man gern etwas mehr gehört, auch wären gerade hier Fußnoten mit Quellenangaben weiterführend und lohnend gewesen.
Zum Schluss sei der knappe Beitrag des Mitherausgeber Christian Riedel über Georg Hermann gesetzt, dessen eigentliche Name Georg Hermann Borchardt war. In den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhundert war vielgelesen und erzielte hohe Auflagen – dann, mit dem Überhandnehmen des Antisemitismus, war er verfemt; seine Bücher gehörten zu denen, die die Nationalsozialisten 1933 dem Feuer überantworteten. Dies hat indessen mit dem Buchtitel „über die Grenze“ lediglich eine einmalige Grenzüberschreitung gemein – vom Gegenwärtigen zum Verschwundenen. Denn im speziell herausgegriffenen Hermann-Roman „Kubinke“ beschreibt Hermann das Berlin der letzten Jahrhundertwende, von dem die Stürme des 20. Jahrhunderts nurmehr stark veränderte Reste übriglassen sollten. Eher geht es hier die Konservierung eines Stadtbildes, das wir trotz aller Unuzlänglichkeiten lieber sähen als das, was zwei Diktaturen und ein katastrophaler Bombenkrieg mit anschließender Kanonade in der Stadt anrichteten. Die Parallele dazu wäre eher das Besingen des „deutschen Waldes“ zu einem Zeitpunkt, als dessen Stämme bereits zu Hunderttausenden als Stempel untertage – in den großen Bergwerken, zum Beispiel in Schlesien und an der Ruhr – missbraucht wurden. Der Buchtitel wirkt speziell hier etwas gewollt.
Zugegebenermaßen hat den Rezensenten dieses Buch zunächst angesprochen, weil es einen für die deutsche Geschichte und damit auch für die Literaturwissenschaft höchst relevanten Zeitraum umfasst. Die Epoche von 1855 bis 1930, die auf dem Titel bereits genannt ist, bildet ziemlich exakt die Jahre ab, in denen sich der alte, immer vorhandene Antisemitismus, der sich vor allem als Antijudaismus darstellte, zu einem noch bösartigeren Phänomen auswuchs: dem „rassisch“ begründeten, rassistischen Antisemitismus. Nur im Falle Georg Hermanns wurde diese Erwartung erfüllt. Vielleicht hätten sich auch andere Autoren finden lassen für solchen einen Band. Exemplarisch möge der Name von Nathan Birnbaum stehen.
Ein wenig irritiert also der Titel des Werkes. „Über die Grenze“. Eine Erschließung neuer Räume, die Translokation fest definierter Kulturen oder eben auch eine Rückkehr würde man erwarten – ganz so, wie es, um ein Beispiel zu nennen, in Theodor Herzls „Altneuland“ oder in „Der Judenstaat“ zu finden ist. Stattdessen ist im Untertitel, und die Lektüre bestätigt es dann auch, von „Ausgrenzungen und Beschränkungen“ zu lesen anstatt von Überschreitungen und Aufbrüchen. Aber eine Ausgrenzung ist eine Verdrängung, die Grenzüberschreitung begeht höchstens derjenige, der ausgrenzt. Einer Beschränkung, wörtlich genommen, wohnt schon gleich gar keine Grenzüberschreitung inne. In der Einleitung ist zu lesen von „Grenzen als entweder formelle oder informelle Institutionen einer Praxis, die jeweils spatial, sozial und insofern senatisch ist“ und die daher eine symbolische Markierung oder Demarkierung erfordere. Ein wenig erscheint diese Definition wie eine komplizierte Umschreibung einer frei definierten Beliebigkeit – am Grundsatz ändert es gleichwohl nichts. „Über die Grenze“ bleibt ein Buch, das durchaus Wissensmehrung bietet.
Trotzdem ist dieser Band eher ein Anfang eines Weges, dessen Ziel gleichwohl unbestimmt ist. Die ‚großen Vier‘ des Realismus – Fontane, Raabe, Storm und Keller – sind vertreten, und auch Robert Musil kommen vor, sogar der etwas in deren Schatten segelnde Keyserling, nicht zu vergessen den Vertreter einer typisch niederdeutschen Literatur, Groth, sowie die lange missverstandenen und deswegen kaum gelesenen Bang, Strindberg und Georg Hermann. Aber welche Grenzen fasst dieser Band denn nun näher ins Auge? Geht es eher um Landes-, Standes-, Kolonialisierungs- oder Dialektgrenzen? Alle, von Fall zu Fall, aber eben nur manchmal; eine durchgängige Thematik ist nicht erkennbar. So fundiert die meisten Analysen auch sein mögen, ein Roter Faden erschließt sich auch aus den Aufsätzen nicht.
Unbeschadet all dessen ist dem Bielefelder Aisthesis-Verlag, der ohnehin ein aufsteigender Verlag mit höchst relevanter Literatur ist, wein weiterer guter Titel gelungen. Dieses Buch ist solide gemacht, wissenschaftlich einwandfrei Inhalte und Aufmachung. Tatsächlich wird indessen beobachtet, konkrete Ergebnisse sind überschaubar, gelegentlich fehlen sie. Vergleichende Betrachtung steht im Vordergrund – aber wenn es eben darum geht, wie so gerne in der Literaturwissenschaft, dann ist dies Projekt als geglückt zu bezeichnen. Preislich konnte der Band zudem im Rahmen gehalten werden, was dem Verlag zu danken ist, weil es bei derart lupenrein wissenschaftlicher Literatur nicht immer der Fall ist.

Harald Hohnsbehn / Matthias Bauer / Christian Riedel (Hgg.), Über die Grenze. Literarische Verhandlungen von Ausgrenzungen und Beschränkungen zwischen 1855 und 1930, Philologie und Kulturgeschichte Band 14, Bielefeld 2024, 229 Seiten, kartoniert, ISBN 978-3-8498-1963-7, 45 Euro. Als E-Book: ISBN 978-3-8498-1964-4.









