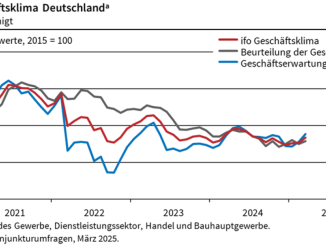Einleitung
I. Ausprägungen des Idealismus
1. Platon und Aristoteles
2. Kant und Schiller
II. Schritte zur Empirie
1. Schopenhauer
2. Habermas
III. Schwankender Grund
1. Thomas Hobbes
2. Albert Camus
Folgerungen und Ausblicke
VORBEMERKUNG
Seit der Antike beschäftigt sich die überlieferte praktische Philosophie mit den Fragen, was im ethischen Sinn als gut und böse zu gelten habe und worin das Fundament des sittlich richtigen Handelns bestehe. Im Anschluss an Platon (428/427-348/347) und Aristoteles (384-322) entwickelte sich eine Fülle verschiedenartiger, teilweise gegensätzlicher Antworten auf die beiden Fragen.
- AUSPRÄGUNGEN DES IDEALISMUS
- Platon und Aristoteles
Sowohl Platon als auch Aristoteles vertraten die optimistische Auffassung, im Menschen selbst, in seiner Seele, sei das Wissen um das Gute und das Böse eingeschrieben. Nach der platonischen Ideenlehre, dargelegt in mehreren seiner Dialoge, tragen wir intelligible Urbilder (paradeigma) der Tugenden und Untugenden in uns. Es gelte nun, so Platon, die Ideen (idea, eidos), etwa die der Gerechtigkeit, in der empirischen Wirklichkeit durch konkrete Handlungen abzubilden, nach dem zu streben, was in der Seele verwurzelt sei. Aristoteles teilte die Überzeugung seines Lehrers Platon, der Mensch könne und solle das in ihm bereits Vorhandene verwirklichen, genauer: Glückseligkeit (eudaimonia) anstreben. Aristotelischer Ansicht zufolge besteht Selbstverwirklichung darin, den Logos, die Vernunft, zu entfalten. Ethisch handeln hieße demnach, vernunftgemäß zu agieren. Dabei komme es auf das rechte Maß an. Dieses „artbildende Merkmal der sittlichen Tüchtigkeit“ meint, „das Mittlere“ zwischen den Extremen des „Zuviel“ und des „Zuwenig“ zu wählen. Trotz des optimistischen Grundzuges räumt Aristoteles ein, es sei durchaus schwer, „ein wertvoller Mensch zu sein; denn in jedem einzelnen Fall die Mitte zu fassen“, sei „keine leichte Sache“.¹ Auf diesen für die vorliegende Bearbeitung wichtigen Aspekt wird noch einzugehen sein.
Welche Rolle spielt die Freiheit in den anfänglichen Konzeptionen ethischer Besinnung? Menschen sind im Rahmen der platonischen und aristotelischen Denkgebäude insofern frei, als sie sich zu entscheiden vermögen, einem obersten Prinzip zu folgen, also sich nicht an einem beliebigem Gut der Sinneserfahrung, sondern am Guten an sich zu orientieren und, geleitet von der Vernunft, zwischen Alternativen das Richtige wählen zu können. Dieser Freiheitsbegriff soll problematisiert werden.
- Immanuel Kant und Friedrich Schiller
Das dargelegte Freiheitsverständnis kehrt in modifizierter Form bei Immanuel Kant (1724-1804) wieder, der mit seiner Auffassung, eine vom Menschen unabhängige Welt-an-sich existiere zwar, sei aber lediglich auf der Ebene ihrer Erscheinungen zu erkennen, einen kritischen oder transzendentalen Idealismus vertrat. Der Königsberger Philosoph verstand die Freiheit zum sittlichen Handeln als Befolgung der uneingeschränkten Pflicht, in der er das absolut Gute erkannte. In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) heißt es, „eine Handlung aus Pflicht“ habe „ihren moralischen Wert nicht in der Absicht, welche dadurch erreicht werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen wird“. Diese wiederum habe sich einzig nach Objektivem zu richten, müsse „aus Achtung fürs Gesetz“ erfolgen. Kant grenzt die strikte Forderung, allein der Pflicht zu genügen, von der Neigung ab: „Nun soll eine Handlung aus Pflicht den Einfluß der Neigung, und mit ihr jeden Gegenstand des Willens ganz absondern, also bleibt nichts für den Willen übrig, was ihn bestimmen könne, als, objektiv, das Gesetz, und, subjektiv, reine Achtung für dieses praktische Gesetz, mithin die Maxime, einem solchen Gesetze, selbst mit Abbruch aller meiner Neigungen, Folge zu leisten.“ In diesem Sinn sittlich zu handeln, das gesteht Kant ein, sei „nur im vernünftigen Wesen“ möglich. Damit, so Kant in der Kritik der praktischen Vernunft (1788), „demütigt das moralische Gesetz unvermeidlich jeden Menschen, indem dieser mit demselben den sinnlichen Hang seiner Natur vergleicht.“ Die Metaphysik der Sitten (1797) richtet sich im berühmten Kategorischen Imperativ, wie Kant selbst sein, variierend formuliertes, unbedingt gültiges Gebot nannte, an die Vernunft des Menschen: „handle nach einer Maxime, die zugleich als allgemeines Gesetz gelten kann.“ Das sei „der oberste Grundsatz der Sittenlehre“.² Dieser sei für alle Menschen zu jeder Zeit und in jeder Situation gültig. In diesem Punkt regiere die Notwendigkeit, nicht die Freiheit.
Die Rigidität seiner Ethik erscheint als Bollwerk gegen die Skepsis, die er in der geschichts- und staatsphilosophischen Schrift Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784) äußert. Da der Mensch dazu neige, seine Freiheit zu missbrauchen, bedürfe es, damit „jeder frei sein kann“, einer übergeordneten Instanz. Dieses „Oberhaupt der öffentlichen Gerechtigkeit“ habe eine „Aufgabe“, deren „vollkommene Auflösung“ Kant „unmöglich“ erscheint: „aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden.“³
Eine der Realität des Menschen verbundene Ethik, welche der Gegenstand dieser Darstellung ist, wird die skeptischen Äußerungen von Aristoteles und Kant über die Natur des Menschen aufgreifen und diese bei den Überlegungen zur Begründung der Sittenlehre angemessen berücksichtigen. Dabei wird auch der Begriff der Freiheit eine entscheidende Rolle spielen.
Gegen die strikte Verpflichtung, die Kant dem Menschen auferlegt, nämlich so zu handeln, als wäre er ein autonomes, reines Vernunftwesen, wandte sich bereits sein Zeitgenosse Friedrich Schiller (1759-1805). Kant nannte das „Joch“ des Gesetzes zwar „sanft“, da „es uns Vernunft selbst auferlegt“ und sprach von der „freien Unterwerfung des Willens unter das Gesetz“, gleichwohl habe seiner Ansicht nach die Pflicht rein gar nichts mit „Herzensaufwallungen“ zu tun.² In seiner philosophisch-ästhetischen Abhandlung Über Anmut und Würde setzt sich Schiller deutlich von der „Härte“ der Morallehre Kants, den er mit Recht zu den „Rigoristen der Moral“ zählt, ab. Dabei verfolgt er das Anliegen, „die Ansprüche der Sinnlichkeit, die im Felde der reinen Vernunft und bei der moralischen Gesetzgebung völlig zurückgewiesen sind, im Feld der Erscheinung und bei der wirklichen Ausübung der Sittenpflicht“ zur Geltung zu bringen.
In gewisser Hinsicht ist Schiller zuzustimmen, wenn er darlegt, dass die Natur den Menschen zu einem „vernünftig sinnlichen Wesen“ geschaffen habe und es deswegen geboten erscheine, „nicht zu trennen, was sie verbunden hat“, mithin „auch in den reinsten Äußerungen seines göttlichen Teiles den sinnlichen nicht hinter sich zu lassen und den Triumph des einen nicht auf Unterdrückung des andern zu gründen“. Würde, wie Kant es tut, die scharfe Trennung vollzogen und dadurch „der sittliche Geist“ mit „Gewalt“ vorgehen, müsse notgedrungen „der Naturtrieb ihm noch Macht“ entgegenstellen. Schiller, der in Kallias oder Über die Schönheit im Brief vom 19. Februar 1793 festhält, dass er „nirgends Zwang sehen“ wolle und ihm „Freiheit das Höchste“ sei, plädiert dafür, dass „in einer schönen Seele […] Sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und Neigung harmonieren“.
Allerdings überhöht auch Schiller das Bild des Menschen, indem er, nicht minder kategorisch als Kant, den Begriff der Vernunft religiös begreift und ein Ideal entwirft. Der sittliche Mensch stimme, so Schiller, mit der göttlichen Vernunft überein. Insofern kann er sagen: „Der Mensch nämlich ist nicht dazu bestimmt, einzelne sittliche Handlungen zu verrichten, sondern ein sittliches Wesen zu sein. Nicht Tugenden, sondern die Tugend ist seine Vorschrift, und Tugend ist nichts anders ‚als eine Neigung zu der Pflicht‘. Wie sehr also auch Handlungen aus Neigung und Handlungen aus Pflicht in objektivem Sinne einander entgegenstehen, so ist dies doch in subjektivem Sinn nicht also, und der Mensch darf nicht nur, sondern soll Lust und Pflicht in Verbindung bringen; er soll seiner Vernunft mit Freuden gehorchen.“ Im Blick auf den Freiheitsbegriff ist mit der Position Schillers im Vergleich zu der Kants nicht viel gewonnen. „Nur im Dienst einer schönen Seele“, stellt Schiller fest, „kann die Natur zugleich Freiheit besitzen und ihre Form bewahren, da sie erstere unter der Herrschaft eines strengen Gemüts, letztere unter der Anarchie der Sinnlichkeit einbüßt.“ Zwar versöhnt Schiller Empfindungen und Pflicht, aber auf eine Weise, die sich weit vom konkreten Menschen entfernt: Der Mensch, idealiter betrachtet, ist nicht frei, zwischen gut und böse zu wählen, vielmehr „sind bei einer schönen Seele die einzelnen Handlungen eigentlich nicht sittlich, sondern der ganze Charakter ist es“.
Schiller entfaltet den Gedanken des Schönen ausführlich in seiner Schrift Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795). Darin unterscheidet er zwischen „sinnlichem Trieb“ und „Formtrieb“ des Individuums. Ersterer „geht aus von dem physischen Dasein“, letzterer „von dem absoluten Dasein des Menschen oder von seiner vernünftigen Natur“. Der Formtrieb ist es, der „Gesetze (gibt)“, also auch das Sittengesetz. Beide Triebe charakterisieren die sinnlich-vernünftige Natur des Einzelnen. Damit keiner der beiden Triebe die alleinige Herrschaft ausübe, ist die Vermittlung zwischen ihnen nötig. Diesen Ausgleich leistet das Schöne, indem es das „Gleichgewicht der Realität und der Form“ bewirkt.⁴
Der so gedachte Mensch, die schöne Seele, kann, recht besehen, nicht böse sein und hat eben deshalb keine Wahl. Mit seiner Auffassung gelangt Schiller letztendlich, wenn auch auf weicheren Sohlen, auf eine vergleichbar abgehobene Ebene wie Kant. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass Kant selbst in der zweiten Auflage seiner Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1794) trotz seines Beharrens auf der strikten Scheidung von Neigung und Pflicht „keine Uneinigkeit“ zwischen dem Standpunkt Schillers und dem eigenen sieht.
- SCHRITTE ZUR EMPIRIE
- Arthur Schopenhauer
Das Ungenügen an der formalen Ethik Kants bekundete neben Schiller auch Arthur Schopenhauer (1788-1860). In seinem moralphilosophischen Hauptwerk Über die Grundlagen der Moral (1840/1841) unterscheidet Schopenhauer „drei Grund-Triebfedern der menschlichen Handlungen“: Egoismus, Bosheit und Mitleid. Der Egoismus bringe „zum Theil moralisch indifferente“, die Bosheit „moralisch verwerflich(e)“ Verhaltensweisen hervor. Einzig im Mitleid sei die „Quelle der Handlungen von moralischem Werth“ zu erblicken. Von entscheidender Bedeutung für das Thema der Ethik auf schwankendem Grund ist, dass sich die Mitleidsethik zunächst auf tatsächliche Gegebenheiten bezieht, also auf wirkliche Handlungen, die aus den drei genannten Motiven − Egoismus, Bosheit oder Mitleid − erfolgen. Schopenhauer schließt nicht aus, dass einer guten Tat egoistische Elemente beigemischt sein können. Gleichwohl gelte, dass „Egoismus und moralischer Werth einer Handlung“ gänzlich unvereinbar seien.
Damit nun ein Akt tätigen Mitleids geschehen könne, müsse sich der Handelnde mit dem Anderen, dessen Wohlergehen er wolle und dessen Leiden er nicht wolle, identifizieren. Dies wiederum bedeute, dass die eigene Individualität ein Stück weit in den Hintergrund trete, dass der „gänzliche Unterschied zwischen mir und jedem Andern, auf welchem gerade mein Egoismus beruht, wenigstens in einem gewissen Grade aufgehoben sei“. Die Fähigkeit des Mitleidens und damit verbunden die Überwindung der Täuschung, das Ich sei der Mittelpunkt, um den sich alles drehen müsse, sei „erstaunenswürdig“, „das große Mysterium der Ethik, ihr Urphänomen“.⁵
Auch Schopenhauer benennt, wie Kant, einen „obersten Grundsatz der Ethik“, den er allerdings aus dem Phänomen des Mitleids, mithin aus der Empirie, herleitet. Den Kategorischen Imperativ weist er als letztlich theologische Annahme zurück. Schopenhauer führt seinen sittlichen Grundsatz, den er im Mitleid verwirklicht sieht, in lateinischer Sprache an: „Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva“ (Verletze niemanden, hilf vielmehr allen, so viel du kannst).⁵ Das Mitleid selbst sei „eine unleugbare Thatsache des menschlichen Bewußtseyns“ und „diesem wesentlich eigen“, sei „ursprünglich und unmittelbar“ und sei „der menschlichen Natur“ eingeschrieben. Aus dem intuitiven „natürlichen Mitleid“ erwüchsen zwei „Tugenden, die der Gerechtigkeit und die der Menschenliebe“, die der Philosoph als „Kardinaltugenden“ bezeichnet, „weil aus ihnen alle übrigen praktisch hervorgehn und theoretisch sich ableiten lassen“.⁵
Um zu einem angemessenen Urteil über Schopenhauers Ethik zu gelangen, ist ein Blick auf seine metaphysische Einstellung nötig, die er in dem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung (1819) entfaltet. Dann wird deutlich, dass er Kant viel näher ist, als es streckenweise den Anschein hat. So folgt er Kant in dessen zentraler Unterscheidung von Welt-an-sich und uns zugänglicher Erscheinungswelt. Erstere sei, wie es in den Prolegomena (1783) Kants heißt, „was sie an sich selbst“ ist, „uns gänzlich unbekannt“.⁶ Was wir als Wirklichkeit wahrnehmen, sei, so Schopenhauer ganz im Sinne Kants, nur das menschliche Bild, das wir uns von ihr machen. „Die Welt ist meine Vorstellung“ lauten entsprechend die Eingangsworte seines Werkes.
Anders als Kant belässt er es allerdings nicht bei der bloß formalen Bestimmung, den Erscheinungen stehe das Ding-an-sich gegenüber, sondern erreicht eine inhaltliche Füllung dessen, was als Erscheinendes hinter der Erscheinung steht: „Der Wille als Ding an sich ist von seiner Erscheinung gänzlich verschieden und völlig frei von allen Formen derselben, in welche er eben erst eingeht, indem er erscheint, die daher nur seine Objektität betreffen, ihm selbst fremd sind.“⁷ Schopenhauer verwendet den Begriff des Willens nicht im herkömmlichen Sinn, versteht ihn nicht als freien Willen – diesen hält er für eine Illusion; denn „das Individuum, die Person“ sei „nicht Wille als Ding an sich, sondern schon Erscheinung des Willens“. Der Wille selbst sei die allen Erscheinungen der menschlichen, tierischen, pflanzlichen und anorganischen Welt zugrunde liegende Urkraft, die „überall Eines und das Selbe“ sei, nämlich irrationaler Überlebenswille. Ausgehend vom Anorganischen äußert sich der Wille in „immer höher stehenden Stufen“ bis hin zur Erkenntnis, zur Vorstellung. Der bewusste Wille sei nicht mehr nur „blinder Drang“, sondern habe „sich auf dieser Stufe ein Licht angezündet“, greife nun „in den Zusammenhang seiner Erscheinungen“ ein. „Die Welt zeigt jetzt die zweite Seite. Bisher bloß Wille, ist sie nun zugleich Vorstellung, Objekt des erkennenden Subjekts.“
Der Wille bildet bei Schopenhauer die metaphysische Größe, mit der er die Wirklichkeit, die ihrerseits nur Trugbilder liefert, erklärt. In Abgrenzung von anderen Positionen erscheint die in allem wirkende Urkraft der Welt eingeschrieben, sie erschafft sich selbst, ist also nicht von transzendenter Art. Es sei nun die Aufgabe des denkenden Menschen, diesem Drang des Entstehens immer neuer Manifestationen des Willens, dieser – buddhistisch gesprochen – „Gier“ des Werdens im Rahmen seiner Möglichkeiten Einhalt zu gebieten. Der dazu geeignete Weg sei die kontemplative Betrachtung der Welt. Hier vollzieht Schopenhauer den Schulterschluss mit Platon: Im Zurücktreten von den Dingen der Erscheinungswelt schaue der Geist die Urbilder alles Wirklichen, in denen sich der dynamische Wille äußere, ehe er sich in der Realität zu erkennen gebe.
Das anschauende Verhalten gegenüber der Welt setzt freilich voraus, dass sich der Mensch, der seinerseits unter den drangvollen Wirkungen des Willens steht, mithin unfrei ist, in Freiheit dazu entscheidet. Hier liegt demnach ein Widerspruch vor. Schopenhauer bietet eine fragwürdige Lösung an, die zeigt, wie sehr er durchaus den Spuren Kants folgt. Es sei nämlich der „intelligible Charakter“ des Menschen, den der Philosoph jenseits aller Erfahrungswirklichkeit, nämlich im vorgeburtlichen Stadium, ansiedelt, der darüber entscheide, ob man bei einer praktischen Handlung ehrlich oder betrügerisch zu Werke gehe. Die tatsächlichen Akte seien determiniert. Die Möglichkeit zur Verneinung des Willens stamme nicht aus dem empirischen Charakter, sondern rühre von der Entscheidung vor der Geburt her.⁷
Die asketische Abwehr der drängenden Urkraft zeige sich in der oben beschriebenen Fähigkeit zum Mitleiden, das die Priorität der Selbsterhaltung aufhebe, so dass sich der Mensch im Leiden des Mitmenschen und dem aller Lebewesen selbst erkenne − das Mitleid wisse um das Band, welches alles verbinde: den Drang zum Leben und den damit einhergehenden Konkurrenzkampf. Die Verneinung des Willens erweise sich mithin als Verneinung der Leid schaffenden Triebfedern des Egoismus und der Bosheit.
Indem Schopenhauers moralphilosophischer Ansatz untrennbar mit seiner Willensmetaphysik verwoben ist, die ihre Wurzeln in der Tradition hat, stellt sich sein ethischer Entwurf lediglich als kleiner Schritt hin zur Empirie dar.
- Jürgen Habermas
Einen weitaus größeren Schritt unternahm der Philosoph Jürgen Habermas (geb. 1929). Er entwickelte neben Karl-Otto Apel (1922-2017) eine eigene Form der Diskursethik. Seine Grundüberzeugung besteht darin, dass die Geltung von moralischen Normen im vernünftigen Gedankenaustausch, mithin im Rahmen der Erfahrungswirklichkeit, zu ermitteln sei. Ziel des argumentativen und dialogischen Verfahrens ist ein kulturübergreifender Konsens. Die Diskursethik knüpft an Kant an, indem sie, wie der Kategorische Imperativ, formal und „universalistisch“ angelegt ist.⁸ Sie grenzt sich sowohl von materialen Wertethiken als auch von Ausprägungen utilitaristischer Ansätze ab. Sie widmet sich also weder der Analyse und Rangordnung von Werten noch erblickt sie in dem, was dem Einzelnen oder einer Gemeinschaft nützlich ist, das Fundament sittlichen Verhaltens.⁹ Für Habermas sind moralische Normen allgemein gültig, wenn sie auf diskursivem Weg die Zustimmung der Mehrheit erlangen. Abweichend von Kant berücksichtigt Habermas auch die möglichen Auswirkungen ethischer Handlungen. Sei eine Norm umstritten, könne sie nur aufrechterhalten werden, „wenn die Folgen und Nebenwirkungen, die sich aus einer allgemeinen Befolgung der strittigen Norm für die Befriedigung der Interessen eines jeden Einzelnen voraussichtlich ergeben, von allen zwanglos akzeptiert werden können“.¹⁰
Die Bezüge der Diskursethik auf die Tradition stehen ihrem modernen Gepräge nicht im Weg. Habermas, der Metaphysik ablehnt,¹¹ übernimmt nicht den transzendentalen Charakter der Kantischen Systematik, sondern geht von dem Kennzeichen der Neuzeit aus, dass die Menschen ohne die normative Orientierung des Handelns durch religiöse Weltdeutungen zurechtkommen müssen. Vor diesem Hintergrund begründet er mit seinem kommunikativen Vernunftbegriff die Ethik auf der rein menschlichen Ebene.
Die angestrebte Argumentationsgemeinschaft existiert freilich, wie Habermas selbst bewusst ist, nicht − sie ist ein Ideal. Die gleichwohl prinzipiell für sinnvoll erachtete Verwirklichung dieses Konstrukts setzt unrealistische Bedingungen voraus, würde nicht nur Einzelne, sondern weite Teile der Bevölkerung überfordern. Alle, die an der anvisierten ethischen Erörterung teilnehmen, müssen zu einer kooperativen Haltung bereit sein, rational kommunizieren, sich untereinander im Hinblick auf Rede und Gegenrede als gleichberechtigt betrachten, individuelle Präferenzen zurückstellen und am Ende dem stichhaltigeren Grund einer Behauptung den Vorzug einräumen, mithin sich dem „eigentümlichen zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ fügen.¹² Das Modell globaler Rationalität verlässt damit den Boden der Wirklichkeit, auf den sich die Diskursethik mit dem Ansatz „der Intersubjektivität möglicher Verständigung“ zunächst begeben hat.¹³ Das, was Habermas vorschwebt, eine vernunftgeprägte Erörterung über Grenzen hinweg, lässt sich bestenfalls rudimentär und höchstens in Kleingruppen umsetzen. Auch Habermas erweist sich somit im Grunde als ein Denker, der die Idee, in seinem Fall das Leitbild einer weltumgreifenden Diskurs-Gesellschaft, gegen die Realität der Unzulänglichkeiten, Spannungen und Widersprüche verteidigt.
III. SCHWANKENDER GRUND
- Thomas Hobbes
Die oben beschriebenen Ethiken weisen Defizite auf: Sie würdigen entweder überhaupt nicht oder nur unzureichend die Realität des Menschen. Über dieser wurde und wird immer wieder ein idealer geistiger Himmel errichtet, sei es ein transzendenter, sei es ein immanenter. Im 17. Jahrhundert legte der englische Philosoph Thomas Hobbes (1588-1679) vor dem Hintergrund der damaligen blutigen Auseinandersetzungen zwischen Krone und Parlament in seinem Land ein Konzept zum Zusammenleben der Menschen in einem wünschenswerten Staat vor, das sich aus der ungeschönten Einsicht in die menschliche Natur speiste. In seiner vierteiligen staatstheoretischen Abhandlung Leviathan, erschienen 1651 in London, beschreibt er den „bloßen Naturzustande des Menschen“. Dieser angenommene vorstaatliche Zustand sei gekennzeichnet durch das allen Menschen gemeinsame Streben nach „Selbsterhaltung“. Aus diesem Grundtrieb heraus erwüchsen leicht Feindseligkeiten; denn wegen des Verlangens nach Vorteilen für die eigene Person, seien es materielle Güter, seien es Ruhm oder Macht, seien Konflikte mit anderen, welche ihrerseits das Bestmögliche für sich wünschen, unvermeidlich. Schnell werde „einer des andern Feind“. Es herrsche „ein Krieg aller gegen alle“.
Wer gewisse zwischenmenschliche Geschehnisse in Geschichte und Gegenwart analysiert, wird den Feststellungen Hobbes‘ schwerlich widersprechen können. Warum gibt es dennoch anscheinend gegenläufige, menschenfreundliche Verhaltensweisen? Die Antwort von Hobbes lautet: Dies sei nur möglich, wenn „eine einschränkende Macht“ der fundamentalen Feindschaft zwischen den Menschen Einhalt gebiete. Um diese Macht zu installieren und so Frieden statt Krieg herbeizuführen und zu sichern, müssten sich „Furcht“ voreinander und „vor einem gewaltsamen Tod“, Zukunftsangst sowie der Wunsch nach einem glücklichen Leben zu einem konstruktiven Bündnis zusammenfinden.
Hobbes stellt neunzehn „natürliche Gesetze“ vor, „welche die Vernunft lehrt“, angefangen von der verbindlichen Regel „suche den Frieden und jage ihm nach“ bis hin zur der Vorschrift, „jeder Streit über eine Sache“ müsse „durch Zeugenaussage“ zur Entscheidung gebracht werden. Unter der Voraussetzung der Erkenntnis, dass nur in einem Friedenszustand das persönliche Glücksstreben gesichert sei, würde dieser „von allen als etwas Gutes und Wünschenswertes betrachtet“. Frieden würden die erwähnten natürlichen Gesetze ermöglichen, so dass „die wahre Sittenlehre“ in der „Kenntnis“ dieser Regeln bestehe. Hobbes begreift die natürlichen Gesetze nüchtern als „allgemeine Wahrheiten darüber, was zur Erhaltung des Menschengeschlechtes erforderlich ist“.
Die spannende Frage ist nun, wodurch die Einhaltung der für das gesellschaftliche Miteinander notwendigen Regeln garantiert ist. Dazu, so Hobbes, bedürfe es einer künstlichen „Gewalt“, einer „Zwangsmacht“. Diese ordnende Herrschaft komme mithilfe von Gesellschaftsverträgen zustande, durch die sich die Menschen ein Gemeinwesen schüfen. Sie täten dies freilich nicht vorrangig aus einem Geselligkeitsstreben heraus, sondern einzig in der Einsicht, dass nur auf diese Weise ihre ureigenen Interessen eines angenehmen Daseins ohne beständige Furcht durchzusetzen seien. Die Menschen übertragen gewissermaßen ihr „Recht“, nämlich die „Freiheit, etwas zu tun oder zu unterlassen“, auf einen Souverän, ihren Repräsentanten. Dadurch werden sie „freiwillig“ zu „Untertanen und Bürger“ in einem „institutionellen Staat“, in welchem Macht und Gewalt zum Zweck der Friedenssicherung, der „gemeinschaftlichen Verteidigung“ und des sozialen Zusammenlebens monopolisiert sind – nämlich im „Oberherrn“, den Hobbes sich als Monarchen vorstellt und den er wegen seiner Machtfülle und seines umfassenden Rechts im Anschluss an das alttestamentliche Buch Hiob als „Leviathan“ bezeichnet.¹⁴
Überzeugend an der Argumentation von Hobbes ist – neben der illusionslosen Zweckbestimmung des Staates − die Schonungslosigkeit, mit der er den im außerstaatlichen Stadium gedachten Menschen charakterisiert. Diese Beschreibung entspricht in weiten Teilen, einesteils verdeckt, anderenteils offen, den tatsächlichen Regungen und Handlungsweisen von Einzelnen, Gruppen und Staaten. Man denke nur an menschenverachtende, kriminelle und kriegerische Akte der Gegenwart: etwa die Behandlung von Arbeitsmigranten im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft sowie die Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen im Golfstaat Katar, die erschreckend hohe Zahl sexueller Gewalt an Kindern, den völkerrechtswidrigen imperialistischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Die in diesen wenigen Beispielen zum Ausdruck kommende entsetzliche Rohheit spiegelt den Rohzustand des Menschen, wie ihn der Leviathan schildert. Allein staatliche Macht kann nach Hobbes anarchische Verhältnisse verhindern und ein gedeihliches Zusammenleben der ihrem Wesen nach wölfischen Menschen und somit Sicherheit und Wohl jedes Einzelnen gewährleisten. Dies gelte allerdings nicht für den Umgang zwischen einzelnen Staaten – bei diesem bleibe etwas von dem Naturzustand erhalten.
- Albert Camus
Gut dreihundert Jahre nach Erscheinen des umfangreichsten politischen Werkes von Hobbes bieten die literarischen und philosophischen Texte sowie persönliche Äußerungen von Albert Camus (1913-1960) aufschlussreiche Gesichtspunkte für das Thema der Ethik auf schwankendem Grund. Im Gegensatz zu den angesprochenen systematischen Ethikentwürfen findet sich bei dem Algerienfranzosen keine normativ-ethische Grundlegung sittlichen Verhaltens, obwohl verantwortbares Handeln sowohl in seinen Werken als auch in seinen Stellungnahmen eine bedeutende Rolle spielt.¹⁵
In dem frei erfundenen Stoff des Romans Die Pest (1947) widersetzt sich insbesondere der Arzt Rieux unermüdlich der zahlreiche Todesopfer fordernden Seuche in der nordafrikanischen Stadt Oran. „Ich werde mich“, erklärt er als Atheist entschlossen gegenüber einem Geistlichen, „bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden“.¹⁶ Auch in dem Dialogstück Die Gerechten (1950), das sich auf historische Tatsachen im zaristischen Russland bezieht, begegnet den Lesern ein ausgeprägtes moralisches Bewusstsein, und zwar in Gestalt Iwan Kaliajews. Der Sozialrevolutionär bekundet vor den Mitgliedern einer Terroristengruppe seine Bereitschaft zum Tyrannenmord. Beim ersten Versuch jedoch wirft er die Bombe nicht, weil zwei Kinder den Großfürsten begleiten. Nach dem schließlich erfolgreichen Attentat durch ihn opfert er das eigene Leben, weil er überzeugt ist, dass die Tötung, obgleich für ihn eine „Tat der Gerechtigkeit“, nur auf diese Weise gesühnt werden könne. Damit bekräftigt er seine Überzeugung vom Wert jedes Menschenlebens.
Dreierlei ist an den beiden Beispielen hervorzuheben. Erstens: In diesen Werken handeln andere Figuren keineswegs moralisch. So gibt es in Die Pest durchaus Nutznießer der katastrophalen Ereignisse, etwa Cottard, der, eines Verbrechens beschuldigt, während der Dauer der Seuche der ausgelasteten Polizei zu entgehen vermag. Und der Moralität Kaliajews steht die brutale Unerbittlichkeit Stepan Fjodorows entgegen, der äußert: „An dem Tag, da wir beschließen, keine Rücksicht auf Kinder zu nehmen, sind wir die Herren der Welt, und an dem Tag wird die Revolution siegen.“¹⁷
Zweitens: Rieux und Kaliajew folgen keinem ausgestalteten ethischen Konzept, keinem theoretischen System allgemein gültiger unbedingter Wertmaßstäbe. Damit stellt sich die Frage, aus welchem Grund Rieux und Kaliajew in Übereinstimmung mit sittlichen Maßstäben handeln, weshalb sie Solidarität und Gerechtigkeit üben. Der Arzt und der Revolutionär fühlen sich durch konkrete Situationen herausgefordert: auf der einen Seite sind es die desaströsen Auswirkungen der hochansteckenden Infektionskrankheit, auf der anderen Seite ist es die Politik der Herrschenden, die zahllose Opfer unter der hungernden russischen Bevölkerung fordert. Die Verhältnisse, denen die handelnden Personen ausgesetzt sind − nicht ein durchgefeiltes Theoriegebilde − wecken ihr Mitgefühl und bestimmen ihren humanen Einsatz. Die jeweilige Lage ist also konstitutiv für die sittliche Entscheidung.
Drittens: Für die Untersuchung der Ethik auf schwankendem Grund ist ferner von Bedeutung, dass die Maßnahmen der Auflehnung gegen menschenverachtende Gegebenheiten nach Camus die Sinnlosigkeit des angetroffenen Geschehens, das Leiden und den Tod nicht verhindern können. Insofern sind die menschenfreundlich Agierenden Repräsentanten des absurden Menschen: Sie engagieren sich gegen das Böse, widerstehen der Unmenschlichkeit, die gleichwohl triumphiert. Inmitten des widersinnigen, keinen objektiven Sinn aufweisenden Weltgefüges erlangen Akte der Empörung und des sittlichen Engagements, so der Philosoph, einen subjektiven Sinn.
Das Stichwort Revolte liefert die Brücke vom literarischen Schaffen Camus‘ zu seiner persönlichen ethischen Haltung. So distanzierte er sich klar sowohl vom totalitären Kommunismus der Sowjetunion als auch vom nationalsozialistischen Regime und setzte sich für einen gewaltfreien Sozialismus ein. Der „Revolution im Namen der Macht und der Geschichte“ wirft er eine „mörderische und maßlose Mechanik“ vor. Ihr stellt er „eine neue Revolte“, die er als „Liebe“ bezeichnet, gegenüber.¹⁸ Diese weiß sich dem Maßvollen und der Anerkennung der Gleichwertigkeit und Würde menschlichen Daseins verpflichtet.
Nun ist aber bemerkenswert, dass Camus der Moral keine kategorische Geltung zuspricht, dass er Apriori-Begriffe des Guten und Gerechten zurückweist, Sittlichkeit also nicht gleichsam über den Menschen stellt. Bezeichnend dafür ist etwa, dass Camus 1946 an den französischen Justizminister schrieb, um sich für den zum Tode verurteilten Kollaborateur und antisemitischen Journalisten Lucien Rebatet (1903−1972) einzusetzen, obwohl er ihn ohne Abstriche für schuldig hielt.¹⁹
Die Humanität, die sich in Camus‘ Texten und seinem eigenen Wirken zeigt, entsteht bei ihm aus der Konfrontation von Individuum und Geschehen. Erst durch die Wahrnehmung zerstörerischer Umstände wird der Einzelne zum sittlich Handelnden. Camus lehnt jeden von außen erhobenen unbedingten Verpflichtungsanspruch ab. In der Begegnung mit Lebensfeindlichem „schreit der Mensch von innen heraus nach Gerechtigkeit“. „Der Mensch“, war Camus überzeugt, „kann alles in sich zügeln, was Zügelung verdient.“¹⁸ Doch dieser Optimismus besitzt einen bitteren Beigeschmack: den der prinzipiellen Nutzlosigkeit moralischen Handelns. Diese resultiert aus der grundsätzlichen Absurdität, welche ihrerseits letztendlich durch die Unausweichlichkeit des Todes gegeben ist. Das Bewusstsein der Endlichkeit nimmt bei Camus einen derart hohen Rang ein, dass im Grunde jegliche Handlung vergeblich ist. Wenn es keine wertsetzende oberste Instanz gibt, ist der Mensch absolut frei. Zwar unterscheiden sich die Verhaltensweisen, aber sie können nicht verbindlich qualifiziert werden. Die Freiheit des absurden Menschen, aus der heraus er entscheidet und sich verhält, bringt es mit sich, dass er keineswegs durchgehend sittlich handelt, also berechenbar wäre. „Man kann auch aus Laune tugendhaft sein“, stellt denn auch konsequenterweise Camus fest.²⁰ Dazu passt eine Briefpassage, in der er „von einem heftigen Bedürfnis nach Gerechtigkeit“ spricht, „das mir schließlich ebenso unvernünftig vorkam wie irgendeine plötzliche Leidenschaft“.²¹ Die Unberechenbarkeit schließt das leidenschaftliche Engagement für den konkreten Mitmenschen durchaus ein, aber eben nur von Fall zu Fall.
Camus‘ Humanitätsverständnis ist eng verwoben mit seiner Liebe zum Leben und zur Sinnlichkeit: „Es gibt einen Lebenswillen, der dem Leben nichts verweigert, und dies ist die Tugend, die ich am höchsten verehre auf dieser Welt“. Solidarität mit Leidenden und Daseinslust waren für ihn keine Gegensätze. Unumwunden stellte er fest, dass „wir für etwas Höheres als die Moral (leben)“.²² Und er folgerte: „Also kann der absurde Geist am Ende seiner Überlegung nicht ethische Regeln suchen, sondern Erklärungen und den Atem menschlichen Lebens.“²⁰ Moralität galt ihm als Ausdruck inniger Lebensbejahung, als Widerstand gegen Menschenverachtung – und eben auch als Ausdruck der Freiheit.
FOLGERUNGEN UND AUSBLICKE
Eine Ethik, die nicht geneigt ist, von einer abstrakten Wesensbestimmung des Menschen und einem metaphysischen Ordnungsdenken auszugehen, wird sich an das Kantische Bild vom „krummen Holze“ und an die Aussage von Aristoteles erinnern, dass es nicht leicht sei, ein guter Mensch zu sein. Sie wird skeptisch sein und sich der Erfahrung verpflichtet fühlen. Deswegen wird sie Freiheit radikaler denken, als dies in den beschriebenen Ethiken idealistischer Welterklärung und auch bei Schopenhauer der Fall ist: dass sie nämlich nicht nur die mögliche Entscheidung für das Gute im Sinne des Menschenfreundlichen einschließt, sondern auch das Böse als Menschenfeindliches. Erst auf diesem Fundament gewinnt eine sittliche Tat ihren moralischen Wert. Denn das Handeln, welches dadurch bestimmt ist, dass, wie Kant forderte, „alle Neigungen verstummen“ und die „Selbstliebe“ schweigt, weckt den Verdacht der Selbstdressur. Moralität und Immoralität lassen sich nicht auf zwei unterschiedliche Menschen verteilen, sondern liegen in ein und demselben Menschen als Potential so nahe beieinander, dass eine Entscheidung für das Gute in einem bestimmten Moment erst dadurch ihre ethische Qualität erhält, dass sie ohne Weiteres auch ganz anders hätte ausfallen können – und zwar ohne dass im Fall des unmoralisch Handelnden dieser sein wahres Menschsein eingebüßt hätte, das laut Kant gerade nicht im „Vermögen der Wahl, für oder wider das Gesetz zu handeln“ besteht, sondern allein „in der Beziehung auf die innere Gesetzgebung der Vernunft“.² „Ein Hund“, ist bei dem österreichisch-britischen Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889-1951) zu lesen, „kann nicht heucheln, aber er kann auch nicht aufrichtig sein.“ Das unterscheidet den einzelnen Menschen vom Tier: Er vermag beides – zu heucheln und aufrichtig zu sein. Wie er sich jeweils verhält, ist nur sehr begrenzt vorhersehbar. Es muss also berücksichtigt werden, „daß ein Mensch“, wie Wittgenstein zutreffend bemerkt, „für einen andern ein völliges Rätsel sein kann.“²³
Ethik – das sollen die Ausführungen zu Camus zeigen − darf den situativen Charakter sittlichen Handelns nicht ausblenden, darf sich nicht jenseits des konkreten Menschen und dessen jeweiliger innerer und äußerer Lage ansiedeln. Der Freiheitsbegriff wird bis zur Unkenntlichkeit entwertet, wenn er in das Junktim mit einer wie immer gearteten intelligiblen Sphäre gezwängt wird, wie es bei Platon und Aristoteles, Kant und auch Schiller sowie Schopenhauer geschieht. Unter einem idealen Himmel fristet die Freiheit ein kümmerliches Dasein. Schiller knüpft zwar, im Unterschied zu Kant, an die Realität (sinnliche Natur) an, lässt sie indessen nicht in ihrem vollen Eigenwert bestehen, sondern legt sie durch die Vorstellung des Schönen in das Prokrustesbett des Wechselspiels von Sinnlichkeit und Form. Der Freiheitsraum schrumpft zusammen, wenn er einzig darin besteht, mit einem gutgeheißenen allgemeinen Sittengesetz übereinzustimmen – sei es freudig und mit „Leichtigkeit“ (Schiller)⁴, sei es als „unbedingte Nötigung“ (Kant)² − oder wenn er, wie bei Schopenhauer, in eine obskure pränatale Phase verlegt wird. Das Misstrauen gegenüber der Sinnlichkeit des Menschen und der damit verknüpften Unberechenbarkeit führte zu Ethiken der Erhabenheit mit dem Ziel, die Triebnatur des Menschen zu bändigen, den natürlichen Egoismus einzuhegen.
Wer sich in der empirischen Welt umschaut, wird unschwer erkennen, dass die erzieherische Intention nicht von Erfolg gekrönt ist. Diesen Befund würden die genannten Philosophen teilen − bereits Schiller befand, die „Charakterschönheit“ sei „bloß eine Idee“, die der Mensch „bei aller Anstrengung nie ganz erreichen kann“.⁴ Gleichwohl würden sie umso energischer die Notwendigkeit und das Gewicht ihrer ethischen Denksysteme betonen.
Nun ist der Aspekt der Umsetzung eines Modells in der Realität noch kein entscheidender Einwand gegen dessen Plausibilität. Es bleibt aber zu fragen, ob es nicht lohnender ist, von vornherein auf der Ebene der Empirie zu bleiben, wie dies bei Hobbes der Fall ist. Metaphysische Ethiken mit dem ihnen zugrunde liegenden Weltbild des Dualismus von Immanenz und Transzendenz lassen sich dann immerhin als Traditionsgut verstehen. Verlässliche anthropologische Aussagen, die der Lebenspraxis standhalten, lassen sich jedenfalls auf dem spekulativen Weg abstrakt-allgemeiner Gedankenkonstruktionen nicht gewinnen. Der Idealismus, die Anschauung also, die Welt sei „als Ganzes, dessen Teile sinnvoll miteinander zusammenhängen“,²⁴ begreifbar, ist ein obsoletes Modell, wie beispielsweise Jürgen Habermas gezeigt hat. Wir stehen der Welt in ihrer Absurdität gegenüber. Das hat Camus schlüssig aufgezeigt. In Samuel Becketts (1906-1989) berühmten Schauspiel Warten auf Godot (1953) erscheint der geheimnisvolle Godot nicht, aber immerhin warten Estragon und Wladimir auf ihn. Wir hingegen warten auf niemanden mehr. „Man hat sich auf das Treiben im Meere dauerhaft einzurichten; von Fahrt und Kurs, von Landung und Hafen ist die Rede längst nicht mehr. Der Schiffbruch hat seine Rahmenhandlung verloren“, brachte es der Philosoph Hans Blumenberg (1920-1996) metaphorisch auf den Punkt.²⁵
Die widersinnige Welt, das ziellose Verweilen auf dem Lebensmeer, das Abenteuer der Freiheit menschlicher Entscheidungen und Handlungen – dies macht den schwankenden Boden einer wirklichkeitsorientierten Ethik aus. Es liegt in der Macht des Menschen, moralisch oder unmoralisch, genauer: moralisch und unmoralisch zu handeln. Als Wesen, das durch Erbanlagen, Sozialisation und gesellschaftliches Leben geprägt ist, verfügt er über mannigfaltige Verhaltensmöglichkeiten. Diese werden durch sittliche und unsittliche Handlungsweisen anderer, die unmittelbar erlebt oder medial vermittelt wurden, zusätzlich erweitert.
Was bleibt an Wirkmöglichkeiten für eine Ethik auf schwankendem Grund? Zunächst wird sie, eingedenk der auf Selbsterhaltung und Selbstförderung der Menschen fußenden Sozialethik und Staatslehre von Hobbes, staatlichen Gesetzen, den Strafandrohungen seitens des Staates, gerichtlich verhängten Strafen sowie deren Vollzug eine sittlichkeitsfördernde Bedeutung nicht absprechen. Das mit dem Rechtswesen verbundene Prinzip der Abschreckung wirkt zweifellos auf das Verhalten und vermag es zu ändern. Allerdings sind hier Einschränkungen zu machen. Zum einen ist die zumindest bei Hobbes vorgenommene Gleichsetzung von sittlich Gutem und Verwerflichem mit juristisch Gutem und Verwerflichem problematisch. Auch ein Unrechtsstaat, der sich als solcher freilich nicht zu erkennen geben wird, agiert auf der Grundlage der von ihm geschaffenen Gesetze. Zum anderen bleibt stets eine gewisse Unsicherheit, ob die Bürger aus Einsicht handeln, sich also mit den gesetzlichen Bestimmungen identifizieren, oder einzig aus Angst vor einer möglichen Verurteilung mit dem Recht übereinstimmen. Und endlich bleiben findigen Naturen immer genügend Schlupflöcher, die das Gesetz nur schwer oder gar nicht erreicht.
Vor diesem Hintergrund wird eine erfahrungsbezogene Ethik ihrer genuinen Aufgabe, Werte zu formulieren, nachzukommen haben. Sie wird dies freilich im Bewusstsein des Wertewandels innerhalb einer Gesellschaft und des von Kultur zu Kultur verschiedenen moralischen Verhaltens tun. Die Vorstellung eines objektiv Guten und die Fixierung auf zu allen Zeiten gültige sittliche Normen wird sie als Anmaßung ebenso zurückweisen wie die Überschätzung des Gewichtes des Intellekts, die der von Habermas entwickelten Diskursethik innewohnt. Sie wird der Wankelmütigkeit des menschlichen Wesens nicht durch Flucht in einen ethischen Rigorismus, wie ihn pointiert Kant vertrat, begegnen; denn Unbeständigkeit ist die Schwester des Zustandes, der Freiheit genannt zu werden verdient. Der Mensch zeichnet sich nicht durch Konsistenz aus, sondern durch Inkonsequenz und Abgründigkeit. Er ist, wie der Religionsphilosoph Martin Buber (1878-1965) schrieb, Teil „der Gegensätzlichkeit alles Innerweltlichen“ und das “in der Gegensätzlichkeit umgetriebene Wesen“²⁶ oder, mit Friedrich Nietzsche (1844-1900) gesprochen, „das noch nicht festgestellte Thier“ – ein Befund, der durch „das Zufällige, das Gesetz des Unsinns im gesammten Haushalte der Menschheit“ unausweichlich sei.²⁷ Es ist demnach wenig aussagekräftig, von einer grundanständigen oder einer fühllosen Person zu sprechen. Menschen reagieren unvorhersehbar auf Reize, die sie aus ihrem Inneren und aus unterschiedlichen Situationen empfangen, auf die sie treffen. Eine freie Persönlichkeit verfügt über eine große Bandbreite von möglichen Handlungsweisen und Reaktionen: Sie kann gütig und gerecht, aber auch unbarmherzig und ungerecht sein, empathisch und geduldig, aber auch kaltherzig und unduldsam, gewissenhaft und bescheiden, aber auch skrupellos und habgierig, ehrlich und hilfsbereit, aber auch unaufrichtig und selbstsüchtig. Es obliegt allein ihm, welche seiner Eigenschaften er in einem bestimmten Augenblick aktiviert. Dabei ist zu bedenken, dass solche und ähnliche Merkmale eher formaler Natur sind und durchaus divergent gedeutet werden können, so dass auch aus diesem Grund von einer uneindeutigen Basis für die Ethik auszugehen ist. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard (1813-1855) bemerkt in seinem umfangreichen Werk Entweder – Oder (1843) zutreffend: „Wer das Ethische wählt, wählt das Gute, das Gute aber ist hier völlig abstrakt, sein Sein ist damit nur gesetzt, und daraus folgt noch keineswegs, daß der Wählende nicht wieder das Böse wählen kann, obwohl er das Gute gewählt hat.“²⁸ Wir kommen nicht umhin, Entgegengesetztes in ein und derselben Person zu sehen. Es liegt nicht in der Macht des Menschen, die konträren Züge seines Wesens sauber zu scheiden, sie auf zwei Individuen zu verteilen, wie dies in der Erzählung Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde (1886) von Robert Louis Stevenson (1850-1894) angestrebt wird – und scheitert.
Es bietet sich an, in diesem Zusammenhang an Nietzsches Überlegungen Zur Geschichte der moralischen Empfindungen zu erinnern, dem Zweiten Hauptstück seines Buches Menschliches, Allzumenschliches (1878). Er stellt fest: „zwischen guten und bösen Handlungen giebt es keinen Unterschied der Gattung, sondern höchstens des Grades.“ Und er liefert sogleich eine Definition: „Gute Handlungen sind sublimirte böse; böse Handlungen sind vergröberte, verdummte gute.“ Als maßgeblich für die konkrete Entscheidung betrachtet er das „Verlangen des Individuums nach Selbstgenuss (sammt der Furcht, desselben verlustig zu gehen)“. Dieses Begehr „befriedigt sich unter allen Umständen“, gleichgültig, ob es sich um „Thaten der Eitelkeit, Rache, Lust, Nützlichkeit, Bosheit, List“ oder um „Thaten der Aufopferung, des Mitleids, der Erkenntniss“ handelt. Das jeweils „mächtigste Motiv“ wird sich durchsetzen. In der für Nietzsche bezeichnenden aphoristischen Zuspitzung spricht er in Hinsicht auf das Handeln des Menschen folgerichtig von dessen „Unverantwortlichkeit und Unschuld“.²⁹
Die Radikalität der Argumentation Nietzsches kann den Blick schärfen für die breite Skala der Handlungssituationen in der Wirklichkeit und somit für den schwankenden Boden der Ethik. Was kann die Reflexion der Taten mannigfaltigster Art und ihrer Konsequenzen angesichts der Unberechenbarkeit auf ihrem ureigenen Feld leisten? Wie lässt sich moralische Sensibilität aufbauen, erhalten und steigern?
Handlungen, die erwünscht sind, und solche, die verhindert werden sollen, lassen sich zu einem beträchtlichen Teil durch Erziehung erreichen. Der Erfolg wird dabei umso größer sein, je günstiger das Wertklima in einer Familie oder einer anderen Kleingruppe ist. Werte, etwa Rücksichtnahme und Gerechtigkeit, sind nur dann überzeugend, wenn sie in einer Atmosphäre des Wohlwollens und der Anerkennung vermittelt werden. Ebenso wichtig ist, zum Ausdruck zu bringen, dass auch moralische Regeln Spielregeln sind, die grundsätzlich auch verletzt werden können. Mit dem Ernst der Unerbittlichkeit ist wenig auszurichten. Die Anleitung beispielsweise zur Wahrhaftigkeit darf die Fähigkeit des Kindes, zu lügen, nicht beschädigen. Wer Regeln nicht zu brechen vermag, ist unfrei und seiner Eigenständigkeit beraubt.
Eine der Empirie verpflichtete Ethik wird neben der Bedeutung der Erziehung den Stellenwert des Vorbildes im Blick haben. Menschen, die, exempli causa, für eine Sache einstehen und insofern moralischen Mut beweisen, können anderen als nachahmenswertes Muster dienen, ohne dass eine direkte Weisung vonnöten ist. Das, was vorgelebt wird, ist allemal plausibler als bloße Belehrung.
Auch das Instrument des Appellierens, des Werbens für das Gute wird eine Ethik auf schwankendem Grund berücksichtigen. Menschen zu einer sittlichen Tat und zu gerechten Stellungnahmen aufzurufen, zum Beispiel Altruismus und Solidarität, Gemeinwohlorientierung und Anteilnahme am Schicksal anderer, Anstand und Toleranz in ihnen zu wecken, kann, wenn die Appellierenden glaubwürdig sind, durchaus Erfolge zeitigen. Menschen akzeptieren nicht selten Autorität, wenn sie spüren, dass ihnen etwas zugetraut wird und sie dadurch in ihrem Selbstwertgefühl aufgewertet werden.
Schließlich wird zu beachten sein, was Kierkegaard mit der Formel „Die Wahrheit ist die Subjektivität“³⁰ auch für das Feld der Ethik ausdrücken wollte: Sittliche Werte lassen sich, genau genommen, nicht lehrend vermitteln; sie entfalten ihre Bedeutung erst, wenn sie von einem existierenden Ich als persönlich relevant eingeschätzt und übernommen werden. Entscheidend ist mithin immer die subjektive Aneignung ethischer Aussagen. Dies macht erneut deutlich, dass mit rein theoretischen Systematiken in der Wirklichkeit nicht viel zu bewegen ist. Lakonisch hält Kierkegaard fest: „dozieren“ bedeute, ethische Überzeugungen „unethisch mitteilen“.³¹ Es wird also darauf ankommen, die Ungewissheit auszuhalten, ob die Verbreitung sittlicher Urteile zu einem subjektiven Akt des Erkennens führt.
Fazit: Eine die Unstetigkeit des Menschen würdigende Ethik wird folgende Aufgaben zu erfüllen haben: Sie wird die Rolle des Staates für das sittliche Zusammenleben bedenken, Werte kritisch reflektieren, das Gewicht der Moralerziehung betonen, die Relevanz von Vorbildern aufzeigen, die Wirksamkeit von ethischen Appellen ins Bewusstsein rufen sowie die eigenen Grenzen anerkennen – mehr vermag sie nicht, aber auch nicht weniger.
___________________
Die Fußnoten erscheinen im laufenden Text jeweils beim letzten Zitat aus dem gleichen Werk. Im Folgenden entsprechen die Seitenangaben der Reihenfolge der zitierten Stellen.
¹ Aristoteles, Nikomachische Ethik, übers. v. Franz Dirlmeier, Stuttgart 1990,
S. 43,44, 52
² Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden, hrsg. v. Wilhelm Weischedel,
Band IV, Darmstadt 1956, S. 26, 27, 194/195, 331, 332, 207, 202, 208,
669, 209, 208, 332, 333, 669
³ Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden, , hrsg. v. Wilhelm Weischedel,
Band VI, Darmstadt 1964, S. 40, 41
⁴ Friedrich Schiller, Sämtliche Werke, Band 5, hrsg. v. Gerhard Fricke u. Herbert
G. Göpfert, 9. Aufl. 1993, S. 465, 464, 465, 407, 468, 464, 465, 469, 468,
612, 604, 605, 619, 407, 470 (zu der hier vorgenommenen Einschränkung vgl.
619)
⁵ Arthur Schopenhauer, Über die Grundlage der Moral, in: Zürcher Ausgabe,
Werke in zehn Bänden nach der historisch-kritischen Ausgabe von Arthur
Hübscher, Band VI, Zürich 1977, S. 249, 243, 245, 248, 251, 252
⁶ Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden, hrsg. v. Wilhelm Weischedel,
Band. III, Darmstadt 1958, S. 152
⁷ Arthur Schopenhauer, Über die Grundlage der Moral, in: Zürcher Ausgabe,
Werke in zehn Bänden nach der historisch-kritischen Ausgabe von Arthur
Hübscher, Band I, Zürich 1977, S. 157, 158, 164, 201, 202, 208
⁸ Jürgen Habermas, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln,
Frankfurt am Main 1983, S. 103
⁹ vgl. hierzu: Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale
Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus,
hrsg. v. Christian Bermes, Hamburg 2014
¹⁰ Jürgen Habermas: Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt am Main 1991,
S. 7
¹¹ vgl. hierzu: Jürgen Habermas, Nachmetaphysisches Denken. Philosophische
Aufsätze, Frankfurt am Main 1988
¹² Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder
Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung?, Frankfurt am Main
1972, S. 137
¹³ Jürgen Habermas, Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien,
Frankfurt am Main 1971, S. 15
¹⁴ Thomas Hobbes, Leviathan. Erster und zweiter Teil, übers. v. J. P. Mayer,
Stuttgart 1970, S. 117, 114, 115, 118, 119, 140, 141, 142, 151, 118, 156,
266
¹⁵ vgl. zum Folgenden: Thomas Berger, Ethik ohne Gott? Albert Camus‘ Ethik
des Widerstehens, in: der blaue reiter. Journal für Philosophie, Ausgabe 47
(1/2021), Hannover 2021, S. 102-104; ders., Albert Camus. Absurdität und
Glück, erweiterte Neuausgabe, Frankfurt am Main 2021
¹⁶ Albert Camus, Die Pest. Roman, übers. v. Guido G. Meister, Hamburg 1957,
S. 128
¹⁷ Albert Camus, Die Gerechten, übers. v. Guido G. Meister, in: Albert
Camus, Ein Lesebuch mit Bildern, Reinbek bei Hamburg, 2003, S. 191,
166/167
¹⁸ Albert Camus, Der Mensch in der Revolte, übertr. v. Justus Streller,
neubearb. v. Georges Schlocker unter Mitarbeit von François Bondy,
Reinbek bei Hamburg 1983, S. 247, 245/246, 245,
¹⁹ Albert Camus, Tagebuch März 1951 – Dezember 1959, übers. v. Guido
G. Meister, Reinbek bei Hamburg 1993, S. 271; vgl. hierzu die
kritischen Ausführungen in der Biografie: Michel Onfray, Im Namen der
Freiheit. Leben und Philosophie des Albert Camus, aus dem Französischen
von Stephanie Singh, München 2013, S. 324-326
²⁰ Albert Camus, Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde,
übers. v. H. G. Brenner und W. Rasch, Hamburg 1959, S. 60
²¹ Albert Camus, Fragen der Zeit, übers. v. Guido G. Meister, Reinbek bei
Hamburg 1977, S. 27
²² Albert Camus, Heimkehr nach Tipasa, in: ders., Literarische Essays, übers.
v. Monique Lang, Reinbek bei Hamburg 1963, S. 189
²³ Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Kritisch-genetische
Edition, hrsg. v. Joachim Schulte, Frankfurt am Main 2001, S. 1086, 1078
²⁴ Jürgen Kaube, Hegels Welt, 5. Aufl., Berlin 2020, S. 22
²⁵ Hans Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer
Daseinsmetapher, Frankfurt am Main 1979, S. 78
²⁶ Martin Buber, Bilder von Gut und Böse, in: Werke, Band 1, München 1962,
S. 613, 614, 616
²⁷ Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, Kritische
Studienausgabe, Band 5, hrsg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari,
München 1988, S. 81
²⁸ Sören Kierkegaard, Entweder – Oder, hrsg. v. Hermann Diem und Walter
Rest, München 1975, S. 718
²⁹ Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches I und II, Kritische
Studienausgabe, Band 2, hrsg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari,
München 1988, S. 104, 103
³⁰ Sören Kierkegaard, Philosophische Brosamen und Unwissenschaftliche
Nachschrift, hrsg. von Hermann Diem, übers. v. Børge Krag Diderichsen
und Susanne Diderichsen, München 1976, S. 328
³¹ Sören Kierkegaard, Die Tagebücher. Eine Auswahl, hrsg. v. Hayo Gerdes, Düsseldorf
1980, S. 135