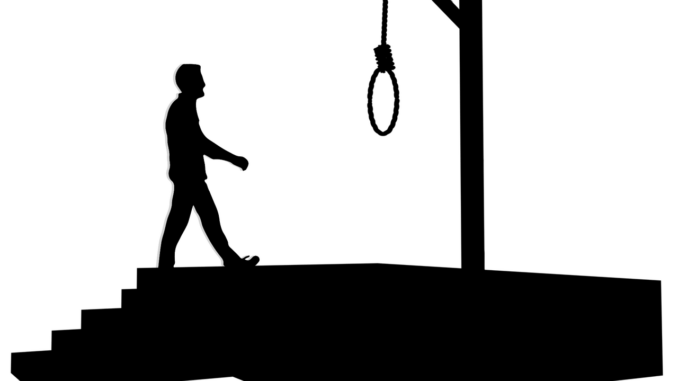
Die Geschichte der Todesstrafe und ihrer Vollstreckung zeigt: Menschen drängten zu allen Zeiten danach, Augenzeuge einer Hinrichtung zu sein, möglichst nah dabei zu sein, um das blutige Ritual zu verfolgen. Entsetzen und Schaudern, Entzücken und Empörung, Emotion und Aktion – die Symbolik der Hinrichtungen konnte ihre Wirkung auf das Volk nur dann entfalten, wenn die Exekutionen öffentlich vollzogen wurden. Das blutige »Schwert des Gesetzes« sollte für alle sichtbar sein. Ein Geschichts-Report von Helmut Ortner
Hinrichtungen stoßen in den USA regelmäßig auf breites Interesse; große Menschenmengen versammeln sich vor den Gefängnissen, wo sie stattfinden, militante Pro-Todesstrafen-Aktivisten und brave Bürger feuern das Hinrichtungsteam lautstark an, wenn es soweit ist; Radio- und TV-Reporter berichten vor Ort. Je prominenter der Delinquent, je spektakulärer der Fall, desto größer das Spektakel. Dabei bleibt – bis auf die offiziellen Justizvertreter, die Anwälte, ausgesuchte Pressevertreter, sowie Familienangehörigen und Zeugen – die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Hinrichtung findet zwar im Namen, aber ohne die Anwesenheit des Volkes statt. Das war nicht immer so.
»Zeig der Menge meinem Kopf; es wird lange dauern, bis sie so etwas wieder sehen«, schrie Danton mit lauter Stimme auf seinem Weg zum Schafott. Es sollte sein letzter großer Auftritt sein. Nicht nur Danton, viele Delinquenten – ob prominent oder namenlos – überließen ihre letzten Rolle nicht dem Augenblick. Sie probten, welche Worte und Gesten ihre letzten sein sollten, welchen Eindruck sie als Hauptdarsteller im Theater des Schreckens hinterlassen möchten. Nicht allen gelang dabei ein so pathetischen Auftritt wie Ludwig XV., der angesichts des nahen Todes seinem Volk zurief: „Franzosen, ihr seht euren König bereit. Bereit, für euch zu sterben. Könnte doch mein Blut euer Glück besiegeln! Ich sterbe ohne Schuld…“. Kaum dass die Worte ausgesprochen waren, war das Haupt auch schon vom Rumpf getrennt. Ein Gehilfe des Henkers Sansons nahm das gefallene Königshaupt vom Boden auf und zeigte es der Menge. Die Mehrzahl wandte sich mit Schaudern ab – aber dabei gewesen sein, das wollte man schon.
Menschen drängten zu allen Zeiten danach, Augenzeuge einer Hinrichtung zu sein, möglichst nah am Bühnenrand zu stehen, um das blutige Ritual zu verfolgen. Entsetzen und Schaudern, Entzücken und Empörung, Emotion und Aktion – die Symbolik der Hinrichtungen konnte ihre Wirkung auf das Volk nur dann entfalten, wenn die Exekutionen öffentlich vollzogen wurden. Das blutige »Schwert des Gesetzes« musste für alle sichtbar sein. Erst dann hatte es eine beruhigende, eine reinigende Wirkung – und eine herrschaftssichernde. »Aufgeklärtes Töten« statt blutrünstige Exzesse – dafür stand die Guillotine. »Sie lässt«, wie der Historiker Daniel Arasse schreibt, »die Rechtsprechung des Volkes eine vernünftige Form annehmen mittels des Instrumentes, welches die Vernunft erdacht hat«. Keine Frage: sie war kühl, sachlich, rational und stand damit auch für die Würde der neuen Ordnung.
Das Schafott: Ort des Frohsinns und Vergnügens
Diese Würde erforderte es, dass die Todeskandidaten ihre Rolle in diesem finalen Schauspiel annahmen. Die einen präsentierten den furchtlosen Abgang, andere schworen ewige Rache, wieder andere entschieden sich für den provokanten, lakonischen oder rebellischen Auftritt. Als Jean-Sylvain Bailly, der alte Bürgermeister von Paris, am 12. November 1793 auf das Schafott geführt wird, rief ein Zuschauer, »Bailly, Du zitterst ja wie Espenlaub…«. Der erwiderte, » Ja, es ist sehr kalt« – und hatte die Lacher auf seiner Seite.
Das Volk drängte zu den öffentlichen Hinrichtungen – es war ein Spektakel der besonderen Art: es wusste nie genau, was es erwartet. Vielleicht war es genau dieses Unvorhersehbare, was der Dramaturgie des Ereignisses eine besondere Faszination verlieh. In Paris verteilte man bereits Tage zuvor lange Listen, auf denen man entnehmen kann, wer wann enthauptet wurde. Nicht nur das: es gab organsierte Touren zu den Hinrichtungsstätten, die besten Plätze rund um das Schafott waren begeht und dementsprechend nur für die wichtigen Bürger reserviert; einige Restaurants in der Nähe der Place de la Republique boten besondere Menüs an – kurzum, die Guillotine war nun einmal die größte Touristenattraktion der Stadt, alle Fremden wollten sie sehen, wollten dabei sein, wenn ihre scharfen Eisen auf das Haupt eines Delinquenten herunterfiel.
In seinem Roman Les Miserables schreibt Victor Hugo: »Das Schafott ist nicht nur ein bloßer Rahmen, das Schafott ist keine Maschine, das Schafott ist kein Träger Teil eines Mechanismus, gefertigt aus Holz, Eisen und Stricken. Es scheint eine Art Wesen zu sein, das gewisse dunkle Ursprünge hat, von denen wir keine Vorstellung haben können; man könnte sagen, dass dieser Rahmen sieht, das diese Maschine versteht, dass dieser Mechanismus begreift; das dieses Holz, dies Eisen und diese Stricke einen Willen haben«.
Freilich: nicht nur in Zeiten der Französischen Revolution gab es genügend Menschen, die angezogen vom blutigen Spektakel staatlich verordneten Grausamkeiten, keine Vorstellung im öffentlich zugänglichen Theater des Schreckens versäumen wollten. Die Hinrichtung als Attraktion, die unmittelbare Erfahrung von Angst und Lust, die »Angst als Genuss ohne Risiko« – das war es, was die Faszination ausmachte: eine Mischung aus Neugierde, Staunen, Schrecken und Mitleid. Dass es ein »fremdes Unglück« sein musste, »dass Menschen zusammenlaufen, um sich Tod und Gefahren anderer anzusehen«, hatte Thomas Hobbes bereits in der Mitte des 17. Jahrhunderts betont. Dass die Massen zu den blutigen Justizspektakeln strömten, ist historisch vielfältig dokumentiert. Häufig trugen sie den Charakter eines Volksfestes. Der Platz rund um das Schafott als Ort des Frohsinns und Vergnügens.
Ehrfurcht vor Gott und Gesetz
Die Ambivalenz des Geschehens, die Wirkungsweisen von persönlicher Distanz und emotionaler Betroffenheit, von Faszination und Schauern, von Ehrfurcht vor Gott und Gesetz und der Sympathie mit dem Delinquenten – fasste Johann Wolfgang Goethes »Wilhelm Meister« gegen Ende des 18. Jahrhunderts in folgende Worte:
»Wie viel Tausende werden unwiderstehlich nach einer Exekution, die sie verabscheuen, hingerissen, wie ängstet sich die Brus der Menge für den Übeltäter, und wie viele würden unbefriedigt nach Hause gehen, wenn er begnadigt würde und ihm der Kopf sitzen bliebe? Das sprudelnde Blut, das den beiden Nacken des Schuldigen färbt, besprengt die Einbildungskraft der Zuschauer mit unauslöschlichen Flecken; schaudern, lüstern blickt die Seele nach Jahren zu dem Gerüste hinauf, lässt alle fürchterlichen Umstände wieder vor sich erscheinen und scheut es, sich selbst zu gestehen, dass sie sich in dem grässlichen Schauspiele weidet.“
Doch niemand zog ernsthaft die Abschaffung öffentlicher Hinrichtungen in Erwägung. Waren es doch Ereignisse, zu denen die Zuschauer-Massen strömten. Sie drängten um das Schafott, je spektakulärer der Mordfall, je prominenter der Delinquent, desto größer der Andrang. Besonders die Enthauptung von Frauen sorgte für Zuschauer-Rekorde. 1831 verfolgten in der Hansestadt Bremen über 30 000 Schaulustige die Hinrichtung der Giftmörderin Gesche Gottfried.
Die Anwesenheit eines möglichst großen Publikums beim Hinrichtungsspektakel – schaudernd oder ausgelassen – für das Gleichgewicht zwischen Obrigkeit und Volk war es nicht nur erwünscht, sondern notwendig. Sie war sichtbarer Beweis dafür, dass das Urteil vom Volk auch angenommen worden war. Denn: nicht die strafende Obrigkeit, sondern nur Gott selbst wurde als Quell allen Rechts betrachtet. Der Staat trat allenfalls als Vermittler göttlicher Gerechtigkeit in Erscheinung. Für die Justiz im 18. Jahrhunderts waren öffentliche Hinrichtungsrituale also nicht nur ein Akt des absolutistischen Staats, sondern immer auch der Versuch eines kommunikativen Einverständnisses zwischen Obrigkeit und Volk. Der dem Staat zu Gebote stehende Apparat der Rechtsdurchsetzung und Strafverfolgung war häufig viel zu schwach, um sich ohne ein Mindestmaß an Konsens des Volkes Geltung verschaffen zu können. Die Auffassung des Volkes von der Todesstrafe verschloss sich hartnäckig den offiziellen Verständnis, allein staatliche Autorität sei Herr über Leben und Tod. Das Volk und deren Volkskultur hielt daran fest, die Hinrichtung als Ausdruck allein der göttlichen Gerechtigkeit zu verstehen, als Ritual der Sühne und Vergeltung, nicht aber als Demonstration der Majestät des Staates.
Der enorme Ansturm brachte durchaus Probleme mit sich, denn die Zuschauer machten Lärm, verunreinigten die Plätze und es kam immer wieder zu handgreiflichen Auseinandersetzungen beim Kampf um die besten Plätze. So erwogen in Berlin die staatlichen Behörden bereits 1820, den Richtplatz am Oranienburger Tor auf die vor der Stadt gelegene Jungfernheide zu verlegen, weil Hausbesitzer reklamierten, die Nähe des Blutgerüst mindere den Wert ihrer Liegenschaft. Hauptargument für eine Verlegung war jedoch die Klage darüber, »dass die Erfahrung lehrt, welche Volksmasse und mit ihr Excesse dadurch herbeigeführt werden«.
1843 beklagte das Kammergericht zu Berlin das Ausbleiben von Kavallerie zur Sicherung der dortigen Hinrichtungen: »Gegen eine Volksmasse, wie sie bei günstiger Jahreszeit Berlin als Zuschauer zu einer Hinrichtung liefern wird, bei der Rohheit und Zügellosigkeit dieser Masse, gewährt aber offenbar Infanterie keinen ausreichenden Schutz.« Aber nicht nur das unziemliche Verhalten der Volksmassen machte den Behörden Sorgen, mitunter auch der Delinquent auf dem Schafott. Nun, da die traditionellen Elemente eines religiös-gottesfürchtigen Rituale aus der Hinrichtungszeremonie zunehmend verschwunden waren, konnten sich die »armen Sünder« – von erneuter Folter-Tortur befreit – ihre Rolle auf der Bühne des Theater des Schreckens selbst schreiben. Sie protestierten, provozierten, feixten, beleidigten und verhöhnten. Besonders bedenklich für die Obrigkeit dabei war, dass dieses freche und kaltblütige Verhalten des Verurteilten in den letzten Augenblicken seines Lebens beim Volk durchaus auf Bewunderung stieß.
Letzter, feierlicher Akt des Staates
Die Befürchtung, öffentliche Hinrichtungen könnten Menschen zum Verbrechen anstiften anstatt sie davon abzuschrecken, die Tatsache, dass sich das Publikum zu Sympathiebekundungen hinreißen ließ, was verschiedentlich gar zu zu Tumulten geführt hatte – all das, nährte die offiziellen Besorgnisse über die öffentliche Ordnung. So wurde schließlich in Preußen unter den Eindrücken der Ereignisse 1847 ein Entwurf des Strafgesetzbuches vorgelegt, nachdem Hinrichtungen künftig nicht mehr öffentlich, sondern in »einem geschlossenen Raume, dem Publikum nicht sichtbar« vollstreckt werden sollten. Auf diesem Wege würden die volksfestartigen Ereignis und das unkontrollierte Verhalten der Zuschauer keine Probleme mehr aufwerfen. Hinrichtungen sollten durch das Läuten einer Glocke angekündigt werden und Justizbeamte sollten dabei jenen, die sich dennoch vor den Hinrichtungsorten versammelten, den tieferen Sinn der Todesstrafe in einer Rede vermitteln. Die Behörde waren der Meinung, dass das Glockenläuten »wohl geeignet ist, Eltern zu vermögen, ihre Familie in dieser Stunde zu religiösen und moralischen Betrachtungen um sich zu sammeln«. Zeitpunkt und Ort der Hinrichtung sollten im Voraus bekannt gegeben werden, selbst ausgesuchte Zeugen konnte der Hinrichtung beiwohnen. Nicht sollte den Eindruck erwecken, dass es sich hier um ein heimlichen staatliches Ereignis handelte. Gleichwohl hatte man eines erreicht, das unkontrollierte Volk gefiltert und geordnet sowie die staatliche Autorität wieder hergestellt.
Die Neuerungen in Preußen verhinderten keineswegs die Begeisterung für öffentliche Hinrichtungen im übrigen Deutschland. Besonders in den Wirren nach der Niederlage der 1948er Revolution war jede Hinrichtung auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, in dem die Zuschauer in Euphorie und Aufregung gerieten und die Obrigkeit mit Schmährufen bedachten. Die Unbezähmbarkeit der Massen schien im Lichte der revolutionären Ereignisse noch immer mehr als bedrohlich.
So wurde bei einer Hinrichtung im mittelfränkischen Ansbach mehr als 20 000 Schaulustige gezählt und bei der Enthauptung des Mörders Josef Stopfer in München am 18. Mai 1950 sollen soll der Andrang von Zuschauern so groß gewesen sein, das der Hinrichtungszug kaum den Weg vom Gefängnis zum Hinrichtungsplatz schaffte. Ein Beamter kommentierte ernüchternd: »Eine solche Hinrichtung ist nichts als Spektakel für ungebildete und Gebildete und kostet dem Staate viel Geld… «.
Es war ein Dilemma. In der Phantasie des aufgeklärten Bürgertums hatte man das Hinrichtungsritual in den vergangenen Jahrzehnten säkularisiert und von den religiösen Vergeltungs- und Erlösungsritualen befreit. Gedacht als letzter, feierlicher Akt des Staates, bei das ehrerbietige Volk zusah, wie der Henker und anderen Staatsautoritäten in Frack und Zylinder mit ernster Miene ihrer Pflicht nachkamen, war der wohl organsierte Staatsakt zu einem unkontrollierten Spektakel geworden. Das sollte nun auch über Preußen hinaus ein Ende haben.
Im Königreich Württemberg benutze man die Gelegenheit der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahre 1853, um die Hinrichtung in einen umschlossenen und kontrollierbaren Raum des Gefängnishofes zu verlegen. In Hamburg wurden öffentliche Hinrichtungen 1856 abgeschafft, ebenfalls im Großherzogtum Baden, das im gleichen Jahr 1856 das preußische System übernahm, nicht zuletzt deshalb, um künftig »Unannehmlichkeiten« zu vermeiden. Die Regierung befand, dass die überwiegende Mehrzahl darin nur ein Schauspiel sähe, »die Befriedigung der rohen Begierde, satt Abscheu vor dem Verbrechen, dass menschliche Sühne finden soll… «. Was Not tue, sei die Beschränkung der Öffentlichkeit, denn, »solche Wirkungen widerstreben aber zu sehr dem Interesse der Sittlichkeit und der Gerechtigkeit, als dass sie länger übergangen werden dürften. Anstatt wie bisher von er Volksmenge beklatscht zu werden, sollten Hinrichtungen im Großherzogtum in Zukunft nur noch in Gegenwart einer beschränkten Zahl obrigkeitlicher Personen und von Zeugen stattfinden«. Allein 12 Zeugen sollten künftig einer Hinrichtung beiwohnen.
In aller Regel waren diese Zeugen männlich. Die Öffentlichkeit war im 19. Jahrhundert ein von Männern dominierter Raum. Frauen galten ohnehin als zu gefühlsbetont und in diesem Sinne als potentiell störend. Schließlich war eine Hinrichtung – vor allem wenn sie nun nicht mehr unter freiem Himmel in einem abgeschlossenen Raum und vor den Augen einer nur geringen Menschenzahl stattfand, eine noch ungewohnte, ernste Veranstaltung. Ein Ort der Würde, der Ruhe, der Autorität – trotz der blutigen Prozedur. Dazu dienten auch neue Rituale. So mussten in Baden zu den Worten »Euer Leben ist verwirkt, Gott sei Euer Seele gnädig«, ein schwarzer Stab vor dem Verurteilten zerbrochen werden und von Anfang bis zum Ende der Hinrichtungszeremonie eine Glocke geläutet werden.
Mit oder ohne Glockengeläut, das Ende der öffentlichen Hinrichtung war besiegelt: das Königsreich Sachsen 1855, Hamburg 1856, das Königsreich Hannover 1860, Rheinhessen 1863 und zwei Jahre zuvor, 1861 auch Bayern, sie alle verlegten – oft im Zusammenhang mit der Einführung öffentlicher Gerichtsverhandlungen – die Hinrichtungen hinter die Gefängnismauern.
Das Publikum war ausgeschlossen, es brauchte nicht wie früher als Legitimation für die Gesetzmäßigkeit des Aktes als Staffage zu dienen. Nicht nur in weiten Teilen Deutschlands, auch in anderen europäischen Ländern wurde die öffentliche Hinrichtung abgeschafft, so 1868 in Österreich und England. Schluss mit kollektivem Voyeurismus und rasender Pöbelei, obsessiver Machtdemonstration und religiöser Überhöhung.
Das Volk freilich, dass nun zu akzeptieren hatte, bei Hinrichtungen nicht mehr Augenzeuge sein zu können, wollte sich nicht ohne weiteres den Ausschluss akzeptieren. Das belegt ein Vorfall, der sich 1853 in Darmstadt zutrug, wo ein stadtbekannter Geschäftsmann eine Tribüne errichtete, auf der Schaulustige gegen Gebühr einen Blick auf den Gefängnishof werfen konnte – und so die dahinter stattfindende Hinrichtung verfolgen konnten.
Auch wenn das Bedürfnis nach dem tödlichen Spektakel ungebrochen war; das Theater des Schreckens, aufgeführt unter freien Himmel, gehörte – zumindest in Deutschland und Teilen Europas – der Vergangenheit an.
Volksfest im »Namen der Gerechtigkeit«
Was bleibt? Die Faszination, Zeuge einer Hinrichtung zu sein, ist kein voyeuristischer Anachronismus. Die Geschichte der Todesstrafe und ihrer Vollstreckung zeigt: Menschen von ambivalenter mentaler Konstitution drängen danach, möglichst nah am Bühnenrand zu stehen. Es braucht nur ein staatlich sanktioniertes Hinrichtungs-Ereignis und die jahrhundertalte Dramaturgie kollektiver Vergeltungsrituale kommt in jeweils neuer zeitgemäßer Inszenierung zur Aufführung. So beispielsweise am 17. Juni 1939 in Versailles, als es schon im Vorfeld der Hinrichtung des Mörders Eugene Weidmann zu tumultartigen Szene gekommen, als Zuschauer bereits am Abend zuvor die Hinrichtungsstätte stürmten, um sich die besten Plätze zu sichern. Polizeikräfte mussten dafür sorgen, dass die Ordnung wiederherzustellen, was jedoch zur Folge hatte, dass sich die Exekution um Stunden verzögerte. Die Bilder erinnerten an eine vergangene Epoche. Das Theater des Schreckens als Neuaufführung. Es sollte eine einmalige Vorstellung bleiben, die letzte öffentliche Hinrichtung in Frankreich sein.
Wie wäre es heute? Die öffentliche Hinrichtung, ein publikumswirksamer »Event«? Ein lebhaftes Volksfest im »Namen der Gerechtigkeit«? Schließlich erginge das Urteil »Im Namen des Volkes«. Es ist zu befürchten, dass es an interessierten Zuschauern nicht mangeln würde Je prominenter der Delinquent, je spektakulärer der Fall, desto grösser das mediale Interesse. Vielleicht böten sich Hinrichtungen gar als quotenträchtiges neues TV-Sendeformat? Prominente Moderatoren, schlagfertige Reporter, dazu Juristen im Expertentalk – unterbrochen von Werbeclips. Finales Reality-TV, gewissermaßen als Weiterentwicklung des bereits existierenden Court-TV, das sich beim amerikanischen Fernsehpublikum großer Beliebtheit erfreut.
Ein zynisches Szenario? Die Möglichkeit, Hinrichtungen im Fernsehen zu zeigen, ist in den USA mehrfach diskutiert worden. Bisher hat sich das Ansinnen nicht durchgesetzt – auch wegen der befürchteten weltweiten Proteste, die solche Übertragungen auslösen würden. Mit einem Rückfall in die eine mediale Barbarei ist also nicht zu rechnen.
Doch öffentliche Hinrichtungen finden statt, weltweit und regelmäßig. In China, im Iran, in Saudi-Arabien, vor allem in moslemisch geprägten Ländern. Sie gehören zum Schreckens-Repertoire religiöser Fundamentalisten und politischer Fanatiker – und das Volk folgt dem Tötungs-Szenario. Schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts stellte Thomas Hobbes verwundert fest, »dass Menschen zusammenlaufen, um sich Tod und Gefahren anderer anzusehen«. Daran hat sich nur wenig geändert. Die Hinrichtung als Attraktion, diese Mischung aus Neugierde, Staunen, Schrecken und Mitleid ist ungebrochen – sie wird es geben, solange es die Todesstrafe gibt.
Zitat:
»Die Faszination, Zeuge einer Hinrichtung zu sein, ist kein voyeuristischer Anachronismus. Die Geschichte der Todesstrafe und ihrer Vollstreckung zeigt: Menschen von ambivalenter mentaler Konstitution drängen danach, möglichst nah am Bühnenrand zu stehen.«
Zum Weiterlesen:
Helmut Ortner,
OHNE GNADE – Eine Geschichte der Todesstrafe,
Nomen Verlag, 230 Seiten, 22 Euro










