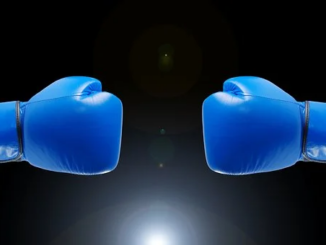Demokratie braucht den Streit, die Kontroverse – auf allen Ebenen: privat, kollektiv, institutionell. Widerspruch und Dissens gegenüber dem Ist-Zustand sind durch unsere Verfassung nicht nur geschützt, sondern konstitutiv verankert. Aber was tun, wenn wie in Corona-Zeiten zivilisierter Streit oft nicht mehr möglich ist?
Derzeit wird viel gestritten. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie polarisiert sich die öffentliche Diskussion. Sie wird lauter, rauer, mitunter vulgär und unerträglich. Auf der Strecke bleibt nicht nur der produktive, zivilisierte Streit, sondern auch die Fähigkeit zum Kompromiss, die unsere Demokratie lebensfähig und zukunftsfähig macht.
Keine Frage: Es soll gestritten werden. Zweifel, Aufbegehren, Widerstand sind keine Untugenden in einer freien Gesellschaft, sondern deren Grundlage. Streit ist konstitutiv für die Demokratie – auf allen Ebenen: privat, kollektiv, institutionell. Unsere Demokratie lebt von der Kontroverse. Nur durch ständige öffentliche Debatte können wir erfolgreich die unterschiedlichen Interessen ausgleichen. »Nur im Streit klären wir, was uns als Gesellschaft wichtig ist, welche Werte wir grundsätzlich vertreten wollen und welche politischen Entscheidungen wir als Gesellschaft zu tragen bereit sind. Am Ende steht der Kompromiss. Er darf nicht der Anfangspunkt einer streitbaren Diskussion sein, sondern deren Endpunkt«, meint Michel Friedman. Der Jurist, Publizist und Philosoph hat ein kompaktes, kluges Buch über das Streiten geschrieben, dass in die Zeit passt. Darin verwebt er Gesellschafts- und Kulturkritik mit philosophischen Reflexionen und persönlichen Erfahrungen. Friedman gilt selbst als überaus streitbarer Mensch, der in seinen medialen Auftritten gekonnt Argumente, Polemik und Selbstinszenierung verwebt, um für seine Positionen öffentlichkeitswirksam einzustehen. Kurzum: ein streitbarer Vertreter demokratischer Streitkultur.
Wann aber kann ein produktiver, ein erkenntnisreicher, guter Streit entstehen? »Das Formulieren der eigenen Position, der Haltung, der These, des Gedankens, das Deutlichmachen, wofür man steht, ist der erste Schritt eines produktiven Streits. Wenn alle Beteiligten den gleichen Raum und die gleiche Aufmerksamkeit bekommen, kann ein guter Streit beginnen«, meint Friedman. Und er verweist darauf, dass in den letzten Jahrzehnten unsere Wohlstands-Demokratie oft davon geprägt war, Konflikte zu vermeiden – und dort, wo sie auftraten, eher zu nivellieren und zu befriedigen. Zuviel – vor allem zu leicht und schnell erreichter – Konsens begünstigt den Opportunismus, er belohnt Kritiklosigkeit, er bedroht die Individualisierung des Denkens. Konformismus statt Pluralismus. Eine offene Gesellschaft aber lebt von Vielfalt, von Streit und Widerstreit. Streit ist Sauerstoff für die Demokratie. Er ist gewissermaßen »systemrelevant«. Friedman plädiert dafür, den »Kooperationsgedanken wieder zu stärken, denn Streit schafft nicht nur soziale Beziehungen, selbst dort, wo zuvor keine waren, ja, er ist selbst eine spezielle Art einer sozialen Beziehung«. Freilich: Demokratie ist nicht Gemeinschaft. Demokratie ist Gesellschaft, also das Aufeinandertreffen und die Akzeptanz unterschiedlicher Interessen, Sichtweisen und Meinungen. Man möchte gern, aber man kann (und muss!) nicht mit jedem streiten. Fanatiker, Extremisten und Populisten hören ohnehin nicht zu. Sie interessieren sich nicht für andere Meinungen. Sie bewegen sich lieber in ihren abgeschotteten Echoräumen. Sie scheuen den Dialog. Sie sind Autisten.
Was tun in diesen aufgeladenen Zeiten? Streiten mit krakeelenden Querdenkern und gewaltbereiten Telegram-Trolls? Mit Esoterik-Schwurblern und selbsternannten »Widerstands-Kämpfern«? Mit betagten Reichsflaggen-Trägern und Jung-Nazis? »Damals wie heute liegt auf der Hand, wie die braun lackierten Scharfmacher zu beurteilen sind und dass es sich verbietet, ihnen »berechtigte Sorgen« zu attestieren. Damals wie heute stellt sich jedoch die Frage, was zu tun sei mit der wachsenden Zahl von Leuten, die bei »Corona-Spaziergängen« und Demos mitlaufen, wiewohl sie sehen, wer vorn die Reden und die Fahnen schwingt. »In meinem Weltbild haften Mitläufer für das, was dort passiert, wo sie mitlaufen«, schreibt Nikolaus Blome in seiner SPIEGEL-Kolumne. Doch er plädiert für Differenzierungen: »Wir sollten Hetzer und Mitläufer nicht in einen Topf werfen. Das Recht jedes Einzelnen auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit ist wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit (worum es den Impfgegnern geht) in unseren Grundrechten verankert.« Was bleibt, ist miteinander streiten. Was sonst?
Die Autorin und Psychiaterin Heidi Kastner macht hier eine Einschränkung: Sie ist der Ansicht, man muss nicht unbedingt die Mühsal des Streitens auf sich nehmen, vor allem dann nicht, wenn keinerlei Dialog- und Kompromiss-Bereitschaft bei den Beteiligten erkennbar ist. Dann, so Kästner in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, verzichte man besser darauf und benennt es als das, was es ist: »nämlich eine zweckbefreite und absehbar ergebnislose Kombination zweier Monologe, und spart sich Mühe, Ärger und Zeit, mit Menschen zu diskutieren, die das Recht auf eine eigene Meinung mit dem Recht auf eigene Fakten verwechseln«. Ich mochte Heidi Kastner hier uneingeschränkt zustimmen.
Auch Stephan Russ-Mühl, emeritierter Medien-Professor an der Universität in Lugano, macht sich Sorgen um die Schäden, die durch diese zunehmende »Diskursunfähigkeit« für das Gemeinwesen und die Demokratie entstehen. Deshalb hat er ein seitenstarkes Buch herausgegeben. Erschienen in einer neuen Schriftenreihe, die sich nichts Geringeres als »die Rettung des öffentlichen Diskurses« vorgenommen hat, plädieren zwei Dutzend Autorinnen und Autoren mit durchaus streitbaren Positionen und Argumenten für mehr »Streitlust und Streitkunst« (so der Titel). Absicht des Herausgebers ist es, der Gefahr der abhanden gekommenen Streitlust wieder etwas Auftrieb zu geben, »im Ton verbindlich, aber in der Sache hart und problemlösungsorientiert«. Diese auch dadurch lebendig werden zu lassen, in dem es selbst ein Spektrum unterschiedlicher Positionen und Argumente repräsentiert, löst das Buch auf angenehme Weise ein. Eine anregende und lesenswerte Lektüre, ein notwendiges Plädoyer für den zivilisierten, empathischen Streit. Denn mehr denn je gilt: Wir brauchen nicht weniger, sondern vor allem besseren Streit.
Michel Friedman: Streiten? Unbedingt! Ein persönliches Plädoyer, Duden Verlag, 64 S., 8 €.
Heidi Kastner: Dummheit, Kreymayr &Scheriau, 128 Seiten, 18 €.
Stephan Russ-Mohl (Hrsg.): Streitlust und Streitkunst,, Hubert von Halem Verlag, 472 Seiten, 28 €.
Vom Autor erschien:
»WIDERSTREIT – Über Wahn, Macht und Widerstand« (2021). Im März erschient sein neues Buch »Volk im Wahn – Hitlers Deutsche, Über die Gegenwart der Vergangenheit in dwr Edition Faust, Frankfurt.
Zitat:
»Nur im Streit klären wir, was uns als Gesellschaft wichtig ist, welche Werte wir grundsätzlich vertreten wollen und welche politischen Entscheidungen wir als Gesellschaft zu tragen bereit sind. Am Ende steht der Kompromiss«.