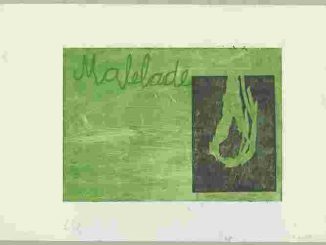Sie haben mit Arno Rink und Werner Tübke geniale Lehrmeister gehabt. DDR-Realismus oder doch mehr?
Michael Triegel: Nun, Tübke war ja, als ich 1990 mit meinem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig begann, längst emeritiert. Ich bin also nicht sein Schüler. Er war mir aber seinerzeit stets eine wichtige Bezugsgröße, quasi ein Autoritätsbeweis, dass es möglich ist, durch Auseinandersetzung mit den alten Meistern und Geschichte, etwas über die Gegenwart zu sagen. Auch war es eine Art Ritterschlag, als er 2003 den Auftrag für die Predella zu einem spätgotischen Altar an mich weitergab. Der Begriff des Sozialistischen Realismus wird leider immer noch sehr pauschal für Kunst aus der DDR verwendet. Die Höllenstürze und manieristischen Überspanntheiten eines Tübke, die mythologischen Parabeln eines Mattheuer, der stets die bestehenden Verhältnisse in seiner Kunst kritisierte oder die Erotomanie und Selbstbeobachtung eines Rink haben ja nichts mit dem Klischee der siegreichen Arbeiterklasse zu tun. Ich hatte das Glück, in einer Zeit zu studieren, in der ich alle bildkünstlerischen Techniken von der Pike auf lernen konnte. Gleichzeitig konnte ich die Meisterwerke, die mich interessierten, überall auf der Welt im Original studieren. Das Studium begann nicht mit theoretischen Diskursdebatten, sondern mit dem Erlernen eines Handwerks – Maltechnik, Perspektive, Anatomie, die grafischen Techniken. Da ging es nicht zuerst um Kunst, sondern um die Voraussetzung, diese zu schaffen. Bis heute ist das Handwerk für mich kein einengendes Korsett. Seine sichere Beherrschung gibt mir im Gegenteil die Freiheit, mich vor dem Bild ganz um den Inhalt zu kümmern. Wir bekamen ein reiches Reservoir an Fertigkeiten vermittelt, das man, wenn es für das Bild notwendig war, jederzeit in einer bewussten Entscheidung reduzieren konnte – aber eben nicht aus Unvermögen oder Faulheit. Arno Rink hatte auch die Gabe des guten Lehrers, nicht in seinen Schülern lauter kleine Rinks zu klonen. Er versuchte jeden zu dessen eigener Sprache zu führen.
Kunst kommt von Können, Goethe hatte noch die Erfindung und den Genius hinzugegeben, erfand mit dem Rubriken-Meyer Regularien. Warum ist zeitgenössische Kunst oft banale Aktionskunst und Happening und auch noch handwerklich schlecht? Haben wir den guten Geschmack verloren?
Michael Triegel: Goethe, der mir sehr wichtig ist, hat ja auch wunderbar über bildende Kunst geschrieben, sehr tiefsichtig über Raffaels Transfiguration. Bei zeitgenössischer Kunst schien er weniger verständnisvoll, wenn sie an seine Ansichten zu Caspar David Friedrich denken. Da griffen seine Kriterien wohl nicht. Welche Kriterien haben wir nun heute? Provokation, Innovation, politische Haltung, Erfolg auf dem Markt – reicht das aus? Für mich ist es wieder an der Zeit, über Ästhetik und auch über die Hergestelltheit von Kunst nachzudenken, Handwerk und Inhalt als Einheit. Wie Hofmannsthal formuliert: „Form ist vom Inhalt der Sinn, Inhalt das Wesen der Form.“ In der Salonmalerei des 19. Jahrhunderts war ein gültiger Kanon hohl geworden. Ein Maler wie Cabanel malte eine Geburt der Venus, bei der es nicht wie bei Botticelli ums Göttliche eines ewig Weiblichen ging, sondern der Voyeurismus des zahlenden Großbürgertums bedient wurde. Dem hat Manet mit seiner Olympia grandios widersprochen, indem er in Form einer Venus von Tizian eine Prostituierte darstellte. Auch die Expressionisten haben mit der Zertrümmerung sämtlicher Konventionen notwendigerweise auf die Katastrophe des Ersten Weltkriegs reagiert, das Bauhaus danach einen inhaltlich und formalen Neuanfang ausgerufen. Aber sind nicht ein permanenter Innovationszwang und sich überbietende Tabubrüche inzwischen auch schon wieder zur Konvention geworden? Gebe ich nicht einen Großteil an Freiheit auf, wenn ich Geschichte, auch Kunstgeschichte als Reflexionsmedien nicht nutze, weil ich es nach neuem Kanon vermeintlich nicht darf, weil ich Gefahr laufe, die Todsünde der Moderne zu begehen, unmodern zu erscheinen. Da gibt es für mich die Chance eines neuen Tabubruchs.
Warum haben Sie gerade die Renaissance-Malerei für sich entdeckt, warum nicht Romantik oder Moderne?
Michael Triegel: Auch die Renaissance hat einen neuen Aufbruch gewagt, indem sie sich mit Altem auseinandersetzte. Etwas Vergessenes muss nicht tot sein. Es kann, gerade weil es unbekannt geworden ist, als neu und jugendfrisch wahrgenommen werden. In der Enge und Tristesse der späten DDR meiner Kindheit erlebte ich die Kunst der Renaissance und auch die Literatur von Ovid über Dante, Goethe, Hofmannsthal oder George als eine Gegenwelt des Geistes, wohl auch der Schönheit. Da glühten die Farben und die archetypischen Themen von Liebe, Leben, Tod und Erlösung sprachen ganz direkt zu mir. Die Fragen des Sokrates und Platon waren mir drängender als die Floskeln im sozialistischen Philosophieunterricht. Ein Kunstwerk, wenn es den Namen verdient, geht für mich immer über die Zeit seiner Entstehung hinaus, wird im unmittelbaren Gespräch mit dem Betrachter, Leser oder Hörer Gegenwart. Die Kunst der Renaissance zeigt ja nicht eine alte Zeit, in der alles gut war. Sie reflektiert durchaus Probleme und Ängste, zeigt aber auch Hoffnungen, Sehnsüchte, Utopien. Dostojewski liebte die Sixtinische Madonna so sehr, weil er meinte durch dieses Bild nicht an der Menschheit verzweifeln zu müssen. Der Mythos in seiner Überzeitlichkeit wie auch der Bezug auf Historisches schaffen mir auch eine Distanz, die möglicherweise einen größeren Überblick ermöglicht. Besonders reizvoll scheint mir dabei, das Ferne durch das Studium der Natur und ihrer Erscheinungen als ein Mögliches, sich gegenwärtig Vollziehendes zu beglaubigen, was Raffael oder Dürer mir so vorbildhaft geschafft haben. Auch deshalb sind mir Stillleben oder Porträts immer wichtig. Apropos: die Maler der Renaissance setzten sich ganz intensiv mit dem einzelnen unverwechselbaren Menschen auseinander. Eine große Tat zu Beginn der Neuzeit, doch auch eine Kinderkrankheit, die im Individualismus unserer Tage problematisch wird, wenn der Einzelne Schwierigkeiten damit hat, eine höhere Instanz als das Ego über sich oder den anderen Menschen neben sich zu sehen.
Ihre Wahlverwandtschaften sind Raffael, Giovanni Bellini, Leonardo, Pontormo, Bronzino – was reizt Sie daran? Sie transportieren christologisch-heilsgeschichtlich und antik-mythologische Themen in die Moderne. Man kann Ihnen also nicht den Vorwurf des Historisierens machen?
Michael Triegel: Historie, Geschichte also und Geschichten sind immer Spiegel einer Gegenwart – der Gegenwart ihrer Entstehung, gleichzeitig aber auch derjenigen, in der sie erzählt, neu gelesen, verändert oder auch anders verstanden und ausgelegt werden. Gerade dieser Transformationsprozess interessiert mich. Nehmen Sie den Mythos der Medea, der, wie ich finde, heute wieder sehr aktuell ist. An der Fremden, der Ausländerin, die aus Rache an Iason die eigenen Kinder tötet, sah der Grieche die Unzivilisiertheit der Barbaren und konnte so die Erzählung politisch instrumentalisieren. Der kleinasiatische Ursprungsmythos erzählt etwas anderes: Hera als Schutzgöttin der ehelichen Treue bietet Medea an, um den Ehebruch Iasons zu sühnen, die gemeinsamen Söhne zu töten und damit die Erbfolge der Herrschaft zu kappen (auch das ein Politikum) und diesen dann Unsterblichkeit zu verleihen. Eine Mutter soll zur Mörderin werden für das ewige Leben ihrer Kinder. Das ist weniger ausländerfeindlich und menschlich viel tragischer. Oder schauen wir auf den Ariadnemythos. Die von Theseus verlassene Ariadne träumt sich in die tote Vergangenheit ihrer großen Liebe, erhofft sich die Auferstehung der guten alten Zeit, nimmt durch den dauernden Schlaf aber ihren Tod vorweg, hofft, dass der ihr erscheinende Gott der Psychopompos Hermes sein möge. Sie projiziert ihre Hoffnungen auf Erlösung auf den ihr Unbekannten. Und siehe, er ist das Gegenteil ihrer Erwartung – Dionysos – der Rausch, die Jugend, der Neubeginn, das Leben. Und doch bleiben die Narben der Vergangenheit, was den Gott menschlich fühlen lehrt. Aber natürlich begeistert mich an den Bildern von Bellini, Raffael oder Bronzino auch, wie sie gemalt sind. Da geht es nicht um „bad painting“, da ist nicht jeder im Sinne von Beuys ein Künstler, da bekommt der Beruf des Künstlers, nicht zuletzt durchs geistige und manuelle Handwerk, eine Einzigartigkeit, Ernsthaftigkeit aber auch Selbstverständlichkeit, die ich ebenso beim Bäcker oder Arzt erwarte und schätze.
Ist Gott aus der Moderne getreten, zumindest in der zeitgenössischen Kunst findet man ihn kaum? Markus Lüpertz sagte in einem Interview, die Künstler seien jetzt die neuen Götter. Hat er Recht?
Michael Triegel: Gut, schon Michelangelo oder Raffael wurden zu ihrer Zeit als „divino“, göttlich bezeichnet. Dürer malt sich im Selbstporträt in Christuspose. Seit der Renaissance wird der Künstler als zweiter Deus creator verstanden. Michelangelo, den ich grenzenlos bewundere, signiert die Pietà im Petersdom auf einem Band über der Brust der Madonna („Michelangelo Buonarroti aus Florenz hat dies gemacht“). Das ist mehr als selbstbewusst. Markus Lüpertz, wenn Sie ihn schon ansprechen, scheint mir eher die Rolle des Malerfürsten des 19. Jahrhunderts zu spielen, eines Markart oder Lehnbach. Wobei sich so die Frage stellt, ob wir wieder eine neue Salonkunst vor uns haben, in deren Mittelpunkt die Person des Künstlers, des „Malerstars“ steht. Ich wünschte mir, dass das Ego des Künstlers hinter dem Werk verschwindet, im Werk aufgeht. Natürlich ist Kunst immer auch hochgradig subjektiv und biografisch, doch sollte nicht der Produzent angebetet werden, der sich sonst zwischen das Kunstwerk und den Rezipienten drängt. Könnten uns sonst die Schöpfungen vieler anonymer Meister so berühren? Marcel Proust beschreibt als sein Ideal eine Heiligenfigur der Kathedrale zu Amiens, die in zwanzig Metern Höhe hinter einem Pfeiler aufgestellt wurde, deren Bildhauer unbekannt ist, die nur während einer Restaurierung von Nahem betrachtet werden konnte, die aber genauso vollendet gearbeitet ist wie die Madonna am Portal. Der mittelalterliche Künstler wusste, zu wessen Ehre er sie schuf. Es war nicht zuerst die seinige.
Haben Sie in ihrem Papstbild auch die Kirche porträtiert, herrisch und zweifelnd? Papa Emeritus begrüßte Sie ja einmal mit den Worten „Sie sind also mein Raffael“.
Michael Triegel: Es gibt eine schöne Aussage Goethes über den Porträtmaler: „Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen, die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von Leuten das Unmögliche und gerade von diesen fordert man es. Sie sollen einem jeden sein Verhältnis zu den Personen, seine Neigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen, sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie ihn jeder fassen würde.“ Das konnte ich beim Porträt Papst Benedikts XVI. erleben. Manche bewunderten es, nur weil der Papst dargestellt war, manche fanden es deshalb furchtbar. Einige meinten gemalte Kritik zu erkennen, andere sahen mich als Hofkünstler. Der eine sah eine herrische und zweifelnde Kirche porträtiert, der andere vermeinte zu wenig jugendliche Frische wahrzunehmen. Ich habe seinerzeit die Audienz sehr ambivalent erlebt. Die Menschen jubelten wie auf einem Popkonzert, nur wenige schienen die berührenden Worte des Papstes über Bonaventura auch nur zu hören, geschweige denn zu verstehen. Mich überkam ein Gefühl der Einsamkeit – mich selbst betreffend, aber auch in Bezug auf diesen großen Intellektuellen, der seine Bücher schreiben, der gelesen und mit seiner Botschaft gehört werden wollte und sich nun in einem solchen Zirkus wiederfand. Irgendwie fand ich durch den Rücktritt Seiner Heiligkeit später mein Porträt beglaubigt. Doch bei jedem Porträt, ob vom Papst oder einem römischen Bettler, versuche ich zuerst das zu malen, was ich unmittelbar sehe, darauf vertrauend, dass sich in der einzigartigen Physiognomie, im Blick, den Falten, der Haltung, den Händen eine Persönlichkeit, ein Leben spiegelt, nicht in den Titeln oder gesellschaftlichen Rollen.
Der Kunstmarkt ist zu einer festen Größe, zum Investment, geworden, Tendenz steigend. Doch eine neue Rezession naht. Werden sich die Preise eher erhöhen oder fallen?
Michael Triegel: Ich bin weder Prophet noch Ökonom und interessiere mich herzlich wenig für den Kunstmarkt. Wichtiger ist doch, wie Kunst auf Krisen reagiert, welche Fragen sie stellt und wie sich das Publikum mit diesen Fragen auseinandersetzt. Vielleicht können wir ja wieder lernen, dass es nicht der Preis ist, der über den Wert eines Kunstwerks entscheidet. Schön wäre es freilich, wenn mancher erkennen möge, dass Kunst, auch ihr Erwerb, als Lebensmittel notwendiger ist als der neuste SUV.
Jeff Koons ist nach seinem Auktionsrekord in New York wieder der teuerste lebende Künstler. Sein „Rabbit“ 91,1 Millionen Dollar wert. David Hockney kommt mit seinem „Portrait Of An Artist (Pool With Two Figures)“ auf 90,3 Millionen Dollar. Sind das nicht absurde Preise, was steckt dahinter, Ästhetik kann es ja wohl nicht sein?
Michael Triegel: Auch 400 Millionen Dollar für das Bild eines Salvator mundi sind nicht gerechtfertigt, selbst wenn es von Leonardo wäre. Vielleicht ist ja Jeff Koons der Künstler der Stunde. Seine Kunst der Oberfläche, der Oberflächlichkeit wird zuweilen als Kapitalismuskritik interpretiert. Interessanterweise wird sie mit ihrem Bling Bling und Glamour besonders von den Oligarchen und Global Playern der Wirtschaft gekauft, die sich durch sie wohl kaum in Frage stellen. Wenn Kultur aus dem Kultus erwächst – denken Sie ans Theater und den Dionysoskult, Götterbilder, Altäre, Herrscherporträts – dann entspricht die Kunst eines Jeff Koons, deren erstgenanntes Merkmal zumeist ihr Preis ist, dem Kult unserer Zeit ums Geld – ein Zynismus, der mich anekelt.
Ein Interpret hat einmal über Ihre Kunst geschrieben: „Das Göttliche wird vermenschlicht, statt entrückter Distanz erlebt der Betrachter private Nähe“. Lässt sich so in Zeiten der Gottesferne, Gott in die Gegenwart zurückholen und Malerei als Repräsentation des Göttlichen, als Imago Dei, neu definieren?
Michael Triegel: Das könnte durchaus sein. Ich hatte bereits angedeutet, dass ich mir nicht am Schreibtisch überlege, welches relevante Problem ich thematisiere, vieles geschieht unbewusst. Ich stelle ganz persönliche Fragen, die, da ich nicht in einem Kloster in der Toskana lebe, auch Fragen meiner Zeitgenossen sein können. Ich male meine Ängste, Sehnsüchte und Zweifel und hoffe, durch die Anschauung der mich umgebenden Welt vielleicht, mit Paulus gesprochen, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren zu gelangen.
Welche Rolle hat das Göttliche in ihrem Werk, sie verbinden ja Transzendentes und Sinnliches miteinander. Oder anders gefragt: Gibt es noch einen Gott in der Moderne? Ein Rezensent hat mal über Sie geschrieben: „Triegels künstlerisches Prinzip ist das der Metamorphose. Wie ein irdischer Demiurg transformiert er den Götterhimmel in ein Reich der Gegenwart“.
Michael Triegel: Da kommen wir doch noch zum Einfluss der Romantik. Als nach der notwendigen Aufklärung der Himmel leergefegt war, erkannten zuerst die Künstler das problematische Vakuum einer Fehlstelle. Novalis suchte die Blaue Blume, eine Wiederverzauberung, Romantisierung der Welt: „Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Sinn gebe, romantisiere ich es.“ Nietzsche, der große Kritiker des Überkommenen aber auch seiner Gegenwart, postulierte den Tod Gottes. Ästhetisch liebe ich die Wiedergeburtsidee der Renaissance und ich glaube an Auferstehung. Die Frage nach Gott oder seiner Abwesenheit stellt sich für mich auch und gerade in der Moderne.
Sie sagen, Ihre Bilder seien Ausdruck des Wunderbaren und betonen zugleich, dass man die Welt nicht mehr mit Rationalität begreifen darf. Kommt dann das Zeitalter einen neuen Sinnlichkeit?
Michael Triegel: Ich kann da nur von mir sprechen. Sinnliches Erleben ist Quelle meines Tuns. Ich habe Probleme mit einer Kunst, die sich zuerst eine theoretische Vorgabe setzt, die sie dann bebildert. Natürlich setzt sich zeitgenössische Kunst mit großen und wichtigen Themen auseinander. Aber auch wenn es um Flüchtlingselend, um Identitäts- oder Genderfragen geht, dürfen wir nicht abstrakt bleiben. Ich finde es schwierig, wenn bei Ai Weiwei lediglich eine Rettungsweste für ein Menschenleben steht oder er sich als berühmter Künstler gar selbst in der Pose des vor Lesbos ertrunkenen Jungen Aylan Kurdi fotografieren lässt und sich somit ein Schicksal anmaßt, das nicht sein eigenes ist – bei aller guten Absicht. Die alten Meister haben bei existenziellen, auch bei theologischen Fragen nach der Menschennatur Christi, nach Schmerz und Leid, aber auch nach Schönheit und Freude zuerst unsere Sinne angesprochen. Das versuche ich auch. Der Blick in die verzweifelten Augen eines leidenden Kindes oder in das gütige Gesicht eines übersehenen Bettlers berühren mich oft tiefer als das Rollenspiel eines Künstlers oder die zuerst als Kunst wahrnehmbare Installation auf einer Biennale.
Sie haben einmal betont, dass Protestanten Musiker und Katholiken Maler hervorbringen, warum?
Michael Triegel: Ach, das war ungerecht. Freilich, wer kommt gegen Bach an? Aber die Katholiken Mozart, Beethoven oder Bruckner waren ja auch nicht schlecht. Und neben Rubens gab es auch Rembrandt. Vielleicht hat die dem Wort dienende Musik im Protestantismus einen ganz eigenen Stellenwert und im Katholizismus die Anschauung, das sich im Sinnlichen der Erscheinung Offenbarende.
Sie haben sich vor einigen Jahren taufen lassen und sind Katholik geworden! Ungewöhnlich in Zeiten zunehmender Säkularisierung? Was macht für Sie das Katholische aus?
Michael Triegel: Scherzhaft könnte ich sagen, da geht der Künstler in provokativen Widerspruch zum Zeitgeist. Böse Zungen könnten meinen, da sucht der in der DDR Sozialisierte wieder eine Autorität. Dass die Suche nach Orientierung, die Sehnsucht nach einem gütigen Vater, dessen Autorität nicht nur Behauptung ist, der Wunsch nach einer letzten Instanz im Glauben Erfüllung fanden, darf ich wohl als Gnade bezeichnen. Zweifel freilich bleiben weiterhin, sie werden zuweilen durch diese Lebensentscheidung zur Taufe noch zwingender. Das Katholische bedeutet für mich durchaus im Wortsinn das Allumfassende. Von der bisweilen fast heidnisch geprägten Volksfrömmigkeit Neapels bis zur Befreiungstheologie, vom Prunk des Petersdoms zu Franz von Assisi, mystischer Spiritualität, Rationalität oder einem philosophischen Ansatz bei Ignatius, Pascal oder Joseph Ratzinger. Da gibt es viele Formen der Näherung an ein Geheimnis, das nie aufhört, Geheimnis zu bleiben.
Italien ist ihr Sehnsuchtsort – Inspirationsquelle. Das Zeitalter der Renaissance ist vorbei, das von Corona eingeläutet! Gottes Strafe? Hat Gott uns jetzt vergessen oder gemäß der Theodizeefrage: Wie kann er das zulassen?
Michael Triegel: Als Maler könnte ich den Versuch wagen, dass nur durch das Grauenhafte als Referenzgröße das Schöne wahrzunehmen ist. Das wäre aber eher eine Versuchung und zynisch, würde es doch das Gute und Böse zu ästhetischen Kategorien machen. Wie ein guter Gott das Schreckliche zulassen kann, das hat ja Theologen und Philosophen seit je umgetrieben. Das Mittelalter hätte wohl einen strafenden Gott gesehen, der uns heute fremd ist. Das Erdbeben von Lissabon 1755 ließ Voltaire in seinem „Candide“ dem Satz von Leibniz, wir lebten in der besten aller Welten, widersprechen und heizte Religionskritik und Aufklärung an. Für mich als unbedarften Laien gäbe es nur den Erklärungsversuch, dass Naturgesetze wie das geologisch-physikalische eines Erdbebens oder das biologische der Mutation von Viren der Schöpfung immanent sind. Letztlich ist für mich die Theodizeefrage nicht zu beantworten, da sie darauf zielt, dass das Geschöpf ein Urteil über den Schöpfer trifft, wissend, was der Plan sei. Trostreich bleibt der Gedanke des Karfreitags, dass Gott mit den Menschen leidet und ihnen hilfreich zur Seite steht als Christus Medicus. Um noch einmal Raffael und Goethe zu bemühen – Raffaels letztes Gemälde stellt die Transfiguration Christi dar, gekoppelt mit der durch die Jünger vergeblich versuchten Heilung des fallsüchtigen Knaben. Die untere Zone der Jünger, der Krankheit, des Irdischen ist dunkel, fast chaotisch im Kontrast zur hellen Klarheit der oben dargestellten Verklärung gemalt. Goethe gibt eine wunderbare, kurze Interpretation: „… beides ist eins. Unten das Leidende, Bedürftige, oben das Wirksame, Hülfreiche, beides sich aufeinander beziehend, ineinander einwirkend.“
Was bedeutet die Coronakrise für die Kunst und den Kunstmarkt?
Michael Triegel: Was sie für den Kunstmarkt bedeutet, kann ich nicht beantworten. Viel wichtiger ist es, was sie für die Kunst, noch mehr, was sie für die Gesellschaft bedeutet. Wir könnten lernen, worauf wir alles verzichten können, auch welche Arbeit wichtig ist und wie sie bezahlt wird. Nach Diskussionen über Rechtschreibreform oder Gendersternchen, durchaus wichtig, treten wieder ganz existenzielle Fragen in den Mittelpunkt, Fragen nach Leben und Tod. Unsere Omnipotenz wird in Frage gestellt und wir werden gezwungen, uns mit unserer Verletzlichkeit und Sterblichkeit auseinanderzusetzen, wieder eine Ars Moriendi zu lernen und dadurch die Schönheit des Lebens und des Augenblicks neu zu schätzen.
Das Gespräch führte Stefan Groß