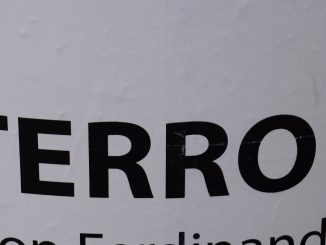Vorworte
Religionskritiken, sowohl gegen ihre ideellen als auch praktischen Grundlagen, werden so alt sein wie die schriftlich fixierten Religionen. Sigmund Freud dürfte sowohl die subtile Kritik Ludwig Feuerbachs (1804-1872), die zersetzende von Karl Marx (1818-1883), aber auch die verzweifelte seines Zeitgenossen Friedrich Nietzsche (1844-1900) studiert haben, denn er beruft sich auf „bessere Männer“, die „vollständiger, kraftvoller und eindrucksvoller“ als er Kritik an der Religion geübt hätten. Er „habe bloß“, wie er bekennt, „der Kritik“ seiner „großen Vorgänger etwas psychologische Begründung hinzugefügt“. Die besseren Männer zählt er nicht auf, denn „es soll nicht der Anschein geweckt werden“, dass er sich „in ihre Reihe stellen will“.
Psychologische Aspekte wurden auch zuvor schon in der Religionskritik geäußert, aber da Freud nun einmal der Begründer der Psychoanalyse ist, konnte keiner zuvor seine Kritik mit psychoanalytischen Begründungen würzen.
Freuds Freund und Kollege Oskar Pfister (1873-1956) bezichtigte ihn 1928 in seinem Aufsatz unter der entgegen gesetzten Überschrift „Die Illusion einer Zukunft“, er habe an die Stelle der religiösen lediglich eine wissenschaftliche Weltanschauung gesetzt. „Freud wollte die bannende Macht des Heiligen“, schreibt Reimut Reiche in seiner Einleitung, „ganz durch die bindende Kraft rationaler Verhältnisse abgelöst sehen, aber er verfügte über kein Instrument, um die andauernde Reduktion von Vernunft und Zweckrationalität, den Missbrauch von Vernunft im einzelnen im Namen von irrationaler Herrschaft im Ganzen zu erkennen.“
Ilse Grubrich-Simitis hingegen vermutete in ihrem biografischen Essay „Freuds Moses-Studien als Tagtraum“, dass Freud vor allem deshalb ein so wütender Atheist war, weil er stets in Versuchung geriet, sich selber mit Moses als Religionsstifter zu identifizieren. Aus seiner eigenen Biografie ließen sich wohl einige Merkwürdigkeiten ableiten, die er selber in die psychischen Macken oder Krankheiten seiner Patienten projizierte. Aber er ist damit weltbekannt geworden, auch wenn sich heute viele Therapeuten bemühen, seine Irrtümer aufzudecken. Allein im Internet erscheinen, wenn man in der Google-Suchmaschine seinen Namen eingibt, ungefähr 28.100.000 Eintragungen in 0,53 Sekunden.
Doch nun zur Sache selber!
I
Im ersten Kapitel seines erstmals 1927 veröffentlichten Essays „Die Zukunft einer Illusion“ wollte er die Kultur untersuchen oder das, was er als „menschliches Getriebe“ bezeichnete, das „nur wenige Personen“, wie er übertrieben optimistisch meinte, „in all seinen Ausbreitungen überschauen können“. Kultur war ihm etwas, „was einer widerstrebenden Mehrheit von einer Minderzahl auferlegt wurde, die es verstanden hat, sich in den Besitz von Macht- und Zwangsmitteln zu setzen“. Das gab ihm Gelegenheit, mit seinen bekannten Begriffen wie „Triebopfer“, Triebunterdrückung“ oder „Triebverzicht“ zu hantieren, was aber noch weit vom Thema Religion entfernt zu sein scheint. Stattdessen räsonierte er über die „kulturfeindliche Mehrheit von heute“, die es gelte, „zu einer Minderheit herabzudrücken“. Das klingt zwar fast marxistisch, also erziehungsdiktatorisch, aber er versicherte, dass es ihm „ferneliegt, das große Kulturexperiment zu beurteilen, das gegenwärtig in dem weiten Land zwischen Europa und Asien angestellt wird“. Er meinte also das grausame „Kulturexperiment“ der Bolschewiki, das nach den revolutionären, jedoch leicht abgewandelten Theorien der Freunde Marx & Engels den europäischen Bürgerkrieg entfachte. Wer sich heute über die Ergebnisse dieses Experiments genauer unterrichten will, sollte das von zumeist ehemaligen Marxisten selber zusammengestellte „Schwarzbuch des Kommunismus“ studieren.
II
Im zweiten Kapitel will uns Freud mit der Erkenntnis beglücken, „dass jede Kultur auf Arbeitszwang und Triebverzicht“ beruhe. Mit Verboten und Entbehrungen habe „die Kultur die Ablösung vom animalischen Urzustand begonnen“. Und noch immer würden die Verbote „den Kern der Kulturfeindseligkeit bilden“, denn unerfüllte „Triebwünsche“ bringe Neurotiker hervor, „die bereits auf diese Versagungen mit Asozialität reagieren“. Unter Triebwünschen zählte er Inzest, Kannibalismus und Mordlust auf. Des Weiteren glaubte er, eine Entwicklung der menschlichen Seele, ähnlich den Fortschritten der Wissenschaft und Technik, nachweisen zu können. Äußerer Zwang habe sich in uns verinnerlicht und „eine besondere seelische Instanz, das Über-Ich“ hervorgebracht, das „ein höchst wertvoller Kulturbesitz“ geworden sei. Doch die Unterschiede zwischen verschiedenen Gesellschaftsklassen bringe es mit sich, dass „die Befriedigung einer Anzahl von Teilnehmern die Unterdrückung einer anderen, vielleicht der Mehrzahl, zur Voraussetzung hat“. Und dies sei bei allen gegenwärtigen Kulturen der Fall. Ergo? „Es braucht nicht gesagt zu werden, dass eine Kultur, welche eine so große Zahl von Teilnehmern unbefriedigt lässt und zur Auflehnung treibt, weder Aussicht hat, sich dauernd zu erhalten, noch es verdient.“ Solche Sätze entsprachen ganz dem Geschmack jener kleinbürgerlichen Revoluzzer, die ab 1968 gegen die mit Hilfe der westlichen Alliierten aufgebaute Nachkriegsdemokratie Sturm liefen.
Was ist geblieben von den hochfahrenden Hoffnungen und Illusionen von Gerechtigkeit und gleicher Triebbefriedigung? Lediglich der von Mao Tse-Tung (1883-1976) nachgeahmte „Lange Marsch“ durch die Institutionen, flankiert von dem Sponti-Spruch „Feuer unterm Arsch verkürzt den langen Marsch!“, verlief bis zur Machtspitze durchaus erfolgreich; das ist in diesem kulturloser werdenden und verarmenden Land auch nicht mehr zu übersehen. Doch ansonsten? „Viel Blödes ist uns geblieben und viel Böses“, meinte dazu der Berliner Soziologie-Professor Alexander Schuller in einer großen Sonntagszeitung: „Da ist vor allem der Affektsturm: das Obszöne, das Vulgäre, das Besessene als vermeintliches Korrelat der Befreiung. In Erinnerung bleibt der entfesselte, der jederzeit zum Sprung bereite hemmungslose Hass.“ Und dann fragte er, welche unerträgliche Kränkung sich da Bahn gebrochen habe. „Manifest war es die Empörung über die Nazi-Sünden der Väter, der ubiquitäre Täter-Verdacht, ein Verdacht, der sich bis in die Gegenwart als Kinderschändungs-Verdacht am Leben hält.“ Ausgerechnet jene 68er, die ihren Vätern den „Nichtwiderstand gegen die Tyrannei“ nicht verzeihen wollten und sich nun im „Widerstand gegen die Nichttyrannei“ hervortaten, übersahen in ihrer ideologischen Verblendung, dass sich auf deutschem Boden tatsächliche eine zweite totalitäre Gewaltherrschaft unter sowjetischer Führung breitgemacht hatte. Doch hier verweigerten sie zumeist den Opfern die Solidarität und machten sich lieber mit den Diktatoren und nicht selten sogar mit den Stasi-Bütteln gemein. Das hieße nach Freud, dass sie sich, als sie noch nicht die Machtzentren des bürgerlichen Staates besetzt hielten, mit den Kräften der Unfreiheit, den Unterdrückern und Besatzern sowohl des deutschen Nachbarstaates als auch der ost- und südosteuropäischen Länder identifizierten, ohne selber davon betroffen zu sein. Zu solcher Infamie hatte Freud noch keine Worte gefunden, die hier zitierbar wären. Am Ende des Kapitels meinte er, das „vielleicht bedeutsamste Stück des psychischen Inventars einer Kultur“ erwähnen zu müssen: „Es sind ihre im weitesten Sinn religiösen Vorstellungen, mit anderen, später zu rechtfertigenden Worten, ihrer Illusionen.“
III
Nun geht Freud der Frage nach, worin der besondere Wert der religiösen Vorstellungen liegt. Es wird deutlich, dass er auch Hegel (1770-1831) studiert hat, denn dieser lehrte sinngemäß, dass die Entwicklung der menschlichen Freiheit in mehreren Etappen verläuft: der orientalische Despot wusste, dass einer frei ist, nämlich nur er. Bei den Griechen und Römern waren einige frei; und in der Welt der Germanen galten alle als frei. Danach Freud der Naturzustand, der zwar keine Triebeinschränkungen verlange, deshalb schwer zu ertragen sei, weil die Natur „kalt, grausam, rücksichtslos“ ist, haben die Menschen sich „zusammengetan und die Kultur geschaffen“, um sich besser gegen die Natur verteidigen zu können. Nur „ein Tyrann, ein Diktator“ kann dieser Logik zufolge als „einziger durch solche Aufhebung der Kultureinschränkungen uneingeschränkt glücklich werden“, wenn alle „anderen wenigstens dies Kulturgebot einhalten: Du sollst nicht töten“.
Gegenüber denjenigen, die wie zum Beispiel die Marxisten daran glauben, dass die Natur „einmal dem Menschen ganz unterworfen sein wird“, zeigte sich Freud äußerst skeptisch. Lediglich eines hob er positiv hervor: „Es ist einer der wenigen erfreulichen und erhebenden Eindrücke, die man von der Menschheit haben kann, wenn sie angesichts einer Elementarkatastrophe ihrer Kulturzerfahrenheit, aller inneren Schwierigkeiten und Feindseligkeiten vergisst und sich der großen gemeinsamen Aufgabe, ihrer Erhaltung gegen die Übermacht der Natur, erinnert.“ Ansonsten sei das Leben eine Zumutung, also „schwer zu ertragen“. Die Natur verhält sich gegenüber dem Menschen gefühllos, ja feindselig; und die Kultur will den Menschen abrichten, einordnen, zurechtstutzen. Das „schwer bedrohte Selbstgefühl des Menschen verlangt nach Trost“. Was macht der ums Überleben kämpfende Mensch? Er beginnt, „die Natur zu vermenschlichen“ indem er den Gewalttaten der Natur zum Beispiel einen bösen Willen unterstellt, und schon glaubt er Wesen um sich zu haben, die ihm bekannt vorkommen, „dann atmet man auf, fühlt sich heimisch im Unheimlichen“ und kann seine „sinnlose Angst“ besser bändigen. Dieser Situation unterstellt Freud „ein infantiles Vorbild“, nämlich die hilflose Situation, in der man sich als Kind gegenüber den Eltern befand, die man einerseits fürchtete, andererseits auch als Beschützer erlebte. So gibt schließlich der verängstigte Mensch den Naturkräften einen „Vatercharakter, macht sie zu Göttern“.
Doch mit der Zeit werden immer mehr Naturgesetze erkannt, die den Naturkräften ihre menschlichen Züge nehmen. „Aber“, so Freud, „die Hilflosigkeit der Menschen bleibt und damit ihre Vatersehnsucht und die Götter“, denen er eine dreifache Funktion zuschreibt:
1. die Schrecken der Natur zu bannen;
2. mit der Grausamkeit des Schicksals, wie es sich besonders im Tode zeigt, zu versöhnen;
3. für die Leiden und Entbehrungen zu entschädigen, die uns durch das kulturelle Zusammenleben aufgenötigt werden.
Im Laufe der weiteren Entwicklungen begreifen die Menschen, dass auch „Götter selbst ihre Schicksale haben“, die sich immer mehr aus der Natur zurückziehen und in die Kultur des Menschen einmischen. Bald bildet sich die Vorstellung heraus, dass das Leben einem höheren Zweck dient, „der zwar nicht leicht zu erraten ist, aber gewiss eine Vervollkommnung des menschlichen Wesens bedeutet“. Die Spaltung des Menschen in Körper und Geist (Seele) bewirkt ein Glaubenkönnen an eine uns überlegene Intelligenz oder später an Hegels Weltgeist, „der schließlich alles zum Guten“ lenkt. „Über jedem von uns wacht eine gütige, nur scheinbar strenge Vorsehung, die nicht zulässt, dass wir zum Spielball der überstarken und schonungslosen Naturkräfte werden; der Tod selbst ist keine Vernichtung, keine Rückkehr zum organisch Leblosen, sondern der Anfang einer neuen Art von Existenz, die auf den Wege der Höherentwicklung liegt.“ Die von den Menschen aus der Not heraus geborenen Kult- und Sittengesetze rücken immer mehr ins Zentrum menschlichen Bewusstseins, „nur werden sie von einer höchsten richterlichen Instanz mit ungleich mehr Macht und Konsequenz behütet“.
Wer das als schlüssig nachvollziehen kann, wundert sich auch nicht mehr, dass nun plötzlich alles „Gute endlich seinen Lohn“ findet, „alles Böse seine Strafe“. Und wenn nicht sofort, dann wenigstens in einer der „späteren Existenzen, die nach dem Tod beginnen“. Es wird in dieser wundervollen Ent-wicklung nicht mehr lange dauern, dann taucht der Konvertit Paulus (5-67) auf, der dann als Apostel verkünden wird: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.” Zuvor lag nur noch die „Kleinigkeit, dass sich die vielen Götter zu einem „göttlichen Wesen“ verdichteten. „Das Volk, dem zuerst solche Konzentrierung der göttlichen Eigenschaften gelang, war nicht wenig stolz auf diesen Fortschritt. Es hatte den väterlichen Kern, der von jeher hinter jeder Gottesgestalt verborgen war, freigelegt; im Grunde war es eine Rückkehr zu den historischen Anfängen der Gottesidee. Nun, da Gott ein Einziger war, konnten die Beziehungen zu ihm die Innigkeit und Intensität des kindlichen Verhältnisses zum Vater wiedergewinnen.“
Freud meinte, dass diese Vorstellungen „ – die im weitesten Sinne religiösen – als der kostbarste Besitz der Kultur eingeschätzt“ werden, „weit höher geschätzt als alle Künste, der Erde ihre Schätze zu entlocken, die Menschheit mit Nahrung zu versorgen oder ihren Krankheiten vorzubeugen“. Überleitend zum Kapitel IV stellte er die Fragen: „Was sind diese Vorstellungen im Lichte der Psychologie, woher beziehen sie ihre Hochschätzung und (…) was ist ihr wirklicher Wert“?
IV
Neu in diesem Kapitel IV ist, dass Freud die Form des Monologs zugunsten eines Dialogs mit einem fiktiven Gegner aufgibt. Als Atheist erklärt er sich die Religion „aus demselben Bedürfnis hervorgegangen wie alle anderen Errungenschaften der Kultur“, die sich also, wie er wiederholt betonte, „gegen die erdrückende Übermacht der Natur zu verteidigen“ habe. Als ein weiteres Motiv käme der Drang hinzu, „die peinlich verspürten Unvollkommenheiten der Kultur“ korrigieren zu wollen. Dasjenige, was als „göttliche Offenbarung“ behauptet wird, „vernachlässigt ganz die uns bekannte historische Entwicklung dieser Ideen und ihre Verschiedenheiten in verschiedenen Zeiten und Kulturen“.
Angesprochen auf sein erstes kulturtheoretisches Werk „Totem und Tabu“ von 1912/13, in dem er den Elternkomplex als „die Wurzel des religiösen Bedürfnisses“ zu erkennen glaubte, räumte er jetzt ein, dass das Verhältnis zum Vater „mit einer eigentümlichen Ambivalenz behaftet“ sei, da „man ihn nicht minder“ fürchte, „als man sich nach ihm sehnt und ihn bewundert“, was übrigens in allen Religionen so sei. Vielen Menschen, welchen Kulturkreises auch immer, sei es gegeben, stets „ein Kind zu bleiben“, das es schaffe, sich die Götter, die es trotz aller Furchtsamkeit für sich zu gewinnen sucht, zu einem Schutzheiligen zu erklären. Dem Motiv solcher Vatersehnsucht verdanke jeder einzelne Schutzbedürftige die „charakteristischen Züge“ der Religionsbildung.
V
Erneut wird die Frage nach der psychologischen „Bedeutung der religiösen Vorstellungen“ aufgeworfen und festgestellt, dass sie „nicht leicht zu beantworten“ sei. Freud wagte dennoch eine Formulierung: „Es sind Lehrsätze, Aussagen über Tatsachen und Verhältnisse der äußeren (oder inneren) Realität, die etwas mitteilen, was man selbst nicht gefunden hat, und die beanspruchen, dass man ihnen Glauben schenkt“. Wer solches in sein Wissen aufgenommen habe, dürfe „sich für sehr bereichert halten“. Wer dennoch die Frage aufwirft, „worauf sich ihr Anspruch gründet, geglaubt zu werden“, erhält drei Antworten, „die merkwürdig schlecht zusammenstimmen“:
1.) Sie „verdienen Glauben, weil schon unsere Urväter sie geglaubt haben“
2.) Wir besitzen „Beweise, die uns aus eben dieser Vorzeit überliefert sind“
3.) Es ist verboten, „die Frage nach dieser Beglaubigung auszuwerfen“.
Das Verbot erweckt in jedem sich aufgeklärt wähnenden Menschen nur Misstrauen, so dass es Freud ein leichtes war, Gegenargumente vorzubringen. Die aus der Vorzeit überlieferten Beweise tragen „alle Charaktere der Unzuverlässigkeit an sich“, sie seien also „widerspruchsvoll, überarbeitet, verfälscht; wo sie von tatsächlichen Beglaubigungen berichten, selbst unbeglaubigt“. So käme es dazu, „dass gerade diejenigen Mitteilungen unseres Kulturbesitzes, die die größte Bedeutung für uns haben könnten“, die „allerschwächste Beglaubigung haben“. Viele Menschen stürzten dadurch in quälende Zweifel, selbst Intellektuelle würden an diesem Konflikt scheitern und sogar „an den Kompromissen“ Schaden nehmen. Was auch immer vorgebracht wurde und wird, um die Zweifel und Absurditäten auszuräumen, für Freud gab es „keine Instanz über der Vernunft“. Und wenn jemand „aus einem ihn tief ergreifenden ekstatischen Zustand die unerschütterliche Über-zeugung von der realen Wahrheit der religiösen Lehre gewonnen hat“, dann fragte er provozierend: „Was bedeutet das dem anderen?“ Auch jene dem „Als ob“ verschriebenen „Künste der Philosophie“ richten bei den nicht davon beeinflussten Personen nichts aus, denn ihnen scheint „mit dem Zugeständnis der Absurdität, der Vernunftwidrigkeit, alles erledigt“ zu sein. Trotzdem sind weltweit die religiösen Vorstellungen nicht tot zu kriegen. Freud fragte, worin „die innere Kraft dieser Lehren“ bestehe, „welchem Umstand verdanken sie ihre von der vernünftigen Anerkennung unabhängige Wirksamkeit“?
VI
Seine Antwort im Kapitel VI lautet: Die religiösen Lehrsätze „sind nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens, es sind Illusionen, Erfüllungen der ältesten, stärksten, dringendsten Wünsche der Menschheit; das Geheimnis ihrer Stärke ist die Stärke dieser Wünsche“. Das zukünftige Leben nach dem Tode stelle „den örtlichen und zeitlichen Rahmen bei, in dem sich diese Wunscherfüllungen vollziehen sollen“. Antworten auf unlösbare Rätselfragen nach dem Woher und Wohin, nach dem Sinn des Lebens, nach der „Beziehung zwischen Körperlichem und Seelischem“ entwickelten sich „unter den Voraussetzungen dieses Systems“, da es „eine großartige Erleichterung für die Einzelpsyche“ bedeute, „wenn die nie ganz überwundenen Konflikte der Kinderzeit aus dem Vaterkomplex ihr abgenommen und einer von allen angenommenen Lösung zugeführt“ würden.
Die religiösen Vorstellungen sind Freud in Gänze unbeweisbare Illusionen, die nicht notwendig ein Irrtum sein müssen, doch niemand dürfe gezwungen werden, sie für wahr halten und an sie glauben zu müssen. Einige dieser Vorstellungen seien jedoch „so sehr im Widerspruch zu allem, was wir müh-selig über die Realität der Welt erfahren haben, dass man sie (…) den Wahnideen vergleichen kann“. Freilich, was unbeweisbar ist, lässt sich auch nicht widerlegen. Ebenso wenig die „überdehnten Bedeutungen“ der Philosophen, die sich „rühmen, einen höheren, reineren Gottesbegriff erkannt zu haben“. Freud meinte, „es wäre ja sehr schön, wenn es einen Gott gäbe“ samt einer gütigen Vorsehung und einer daraus ableitbaren Weltordnung und obendrauf noch ein jenseitiges Leben, aber es sei doch „sehr auffällig, dass dies alles so ist, wie wir es uns wünschen müssen“. Wer sich jedoch „demütig mit der geringfügigen Rolle des Menschen in der großen Welt bescheidet“, sei „irreligiös im wahrsten Sinne des Wortes“.
VII
Freud ist sich durchaus der kulturtragenden und ordnungsstiftenden Bedeutung der Religion bewusst. Über seinen fiktiven Gegner lässt er uns mitteilen, dass man über die religiösen Lehren nicht „klügeln“ dürfe wie „über einen beliebigen anderen“ Gegenstand, denn „unsere Kultur ist auf ihnen aufgebaut, die Erhaltung der menschlichen Gesellschaft hat zur Voraussetzung, dass die Menschen in ihrer Überzahl an die Wahrheit dieser Lehren glauben. Ansonsten breche wieder das Chaos aus, „das wir in vieltausendjähriger Kulturarbeit gebannt haben“. Und wer möchte schon gern unzähligen Menschen den Trost rauben, den sie in der Religion finden und mit deren Hilfe das Leben erst erträglich wird? Doch Freud hat sich auf solche Anklagen vorbereitet, „ihnen allen zu widersprechen“. Er sieht „eine erschreckend große Anzahl von Menschen“, die „mit der Kultur unzufrieden und in ihr unglücklich ist, sie als ein Joch empfindet, das man abschütteln muss“. Die Un-sittlichkeit habe „zu allen Zeiten an der Religion keine mindere Stütze gefunden als die Sittlichkeit“. Die Religionskritik habe „die Beweiskraft der religiösen Dokumente angenagt, die Naturwissenschaft die in ihnen enthaltenen Irrtümer aufgezeigt, der vergleichenden Forschung“ sei „die fatale Ähnlich-keit der von uns verehrten religiösen Vorstellungen mit den geistigen Produkten primitiver Völker und Zeiten aufgefallen“.
Der “wissenschaftliche Geist“ erzeuge „eine bestimmte Art, wie man sich zu den Dingen dieser Welt einstellt; vor den Dingen der Religion macht er eine Weile halt, zaudert, endlich tritt er auch hier über die Schwelle“. Doch wohin tritt der Wissenschaftler? In die „einzige wissenschaftliche Weltanschauung“, wie der Marxismus selbstherrlich genannt wurde? Ich vermute, dass heute unter den Natur-Wissenschaftlern – im Gegensatz zu den Geisteswissenschaftlern – mehr religiös Bekennende als Marxisten existieren, soll heißen, rationales Denken hält viele Wissenschaftler nicht von einem religiösen Glauben ab, zumal sie nun auch noch mit wissenschaftlichen Methoden fest-gestellt haben, dass religiös praktizierende Menschen länger und gesünder leben. Außerdem wissen viele, die allzu viel wissen, dass sie nichts wissen, jedenfalls nichts Wesentliches. Mit Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716) lässt sich nämlich noch immer staunend fragen: „Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“
Andererseits ist es nicht zu übersehen, dass die Verbreitung wissenschaftlicher Lehrgebäude den „Abfall vom religiösen Glauben“ und den Anstieg von Depressionen in unserem Kulturkreis beschleunigt haben.
VIII
Das Kapitel VIII beginnt Freud sozusagen mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Was lässt sich gewinnen, wenn die Religion aus der Kultur verschwindet? Zwar gibt er zu, dass sich die Zehn Gebote der Bibel in „alle weiteren kulturellen Einrichtungen, Gesetze und Verordnungen ausgebreitet“ haben, doch denen stehe „der Heiligenschein oft schlecht zu Gesicht“, so dass es ein „unzweifelhafter Vorteil“ wäre, „Gott überhaupt aus dem Spiel zulassen und ehrlich den rein menschlichen Ursprung aller kulturellen Ein-richtungen und Vorschriften einzugestehen“. Freud unterstellte, dass die „Gebote und Gesetze“ einem Herrschaftsanspruch dienten, und er glaubte, dass die Menschen „ein freundlicheres Verhältnis zu ihnen gewinnen“ könnten, wenn sie erkennen, dass sie vielmehr geschaffen sind, ihren Interessen zu dienen: „Das wäre ein wichtiger Fortschritt auf dem Wege, der zur Versöhnung mit dem Druck der Kultur führt.“
Freud räumte auch ein, „dass der Schatz der religiösen Vorstellungen nicht allein Wunscherfüllungen enthält, sondern auch bedeutsame Reminiszenzen“. Zu diesem Zusammenwirken von Vergangenheit und Zukunft sagte er nur staunend: „…welch unvergleichliche Machtfülle muss es der Religion verlei-hen!“ Einerseits sprach er sich für die Entmachtung der Religion aus, andererseits setzte er sich für ihre Entmythologisierung ein, gewissermaßen dem späteren Theologen Rudolf Bultmann (1884-1976) das Stichwort liefernd: „Die Wahrheiten, welche die religiösen Lehren enthalten, sind doch so ent-stellt und systematisch verkleidet, dass die Masse der Menschen sie nicht als Wahrheit erkennen kann“.
Da Freud unterstellte, es gäbe eine „allgemein menschliche Zwangsneurose“, die faktisch jeder habe, der unter der Erziehung eines Vaters aufwuchs und deshalb in seiner Kindheit unter einem Ödipuskomplex leiden musste; deshalb wäre vorauszusehen, „dass sich die Abwendung von der Religion mit der schicksalhaften Unerbittlichkeit eines Wachstumsvorganges vollziehen muss“. Doch das Wesen der Religion ist mit dieser Diagnose nicht erschöpft, denn sie enthält nämlich noch „ein System von Wunschillusionen mit Verleugnung der Wirklichkeit, wie wir es isoliert nur bei einer Amentia, einer glückseligen halluzinatorischen Verworrenheit, finden“. Sein Gegenmittel ist bekanntlich die Analyse, also die rationelle Geistesarbeit, obwohl er doch ansonsten das Triebleben und die Leidenschaften des Menschen für die ihn beherrschende Kraft hält.
IX
Freuds fiktiver Gegner weist auch auf die Tatsache hin, dass solche Versuche, „die Religion durch die Vernunft ablösen zu lassen“ mindestens schon zweimal kläglich gescheitert sind: in der Französischen Revolution unter Maximilien de Robespierre (1758-17994) und unter dem marxistisch-leninistischen Experiment in Russland. Freud setzte diesem Argument hauptsächlich die Kritik an der Kinder-Erziehung entgegen: „Verzögerung der sexuellen Entwicklung und Verfrühung des religiösen Einflusses, das sind doch die beiden Hauptpunkte im Programm der heutigen Pädagogik, nicht wahr?“ Er hätte lieber eine „Erziehung zur Realität“ installiert, was immer das heißen mag, denn „der Mensch kann nicht ewig ein Kind bleiben, er muss endlich hinaus ins ‚feindliche Leben’“. Das was hier so martialisch klingt, entpuppt sich als idyllischer Kitsch, denn der wissenschaftsgläubige Mensch wird als „ehrlicher Kleinbauer auf dieser Erde (…) seine Scholle zu bearbeiten wissen, so dass sie ihn nährt“. Zieht der Kleinbauer nur seine überflüssigen „Erwartungen vom Jenseits“ ab und konzentriert dann „alle freigewordenen Kräfte auf das irdische Leben“, kann eigentlich dem Paradies auf Erden nichts mehr entgegenstehen. Fröhlich wird er im Winterurlaub nach Versen Heinrich Heines (1797-1856) trällern: “Ja, Zuckererbsen für jedermann, / Sobald die Schoten platzen! / Den Himmel überlassen wir / Den Engeln und den Spatzen.“
X
Im X. Gebot – Pardon! – im X. Kapitel wirft der fiktive Gegner Freud vor, selber Illusionen zu produzieren, was Freud auch zugibt. Doch seine Illusionen wären „nicht unkorrigierbar wie die religiösen“ oder gar von „wahnhaften Charakter“. Er sei aber „optimistisch genug anzunehmen, dass die Menschheit diese neurotische Phase überwinden wird, wie so viele Kinder ihre ähnliche Neurose auswachsen“. Er setzt voll auf den „Primat des Intellekts“, dessen alles erlösender Herrschaft dann „die Menschenliebe und die Einschränkung des Leidens“ herbeiführen wird. Auch wenn die „ersten Versuche misslingen“, aber das Fallenlassen der Religion sei nicht aufzuhalten, denn „auf die Dauer kann der Vernunft und der Erfahrung nichts widerstehen“. Wer sich von der Leibeigenschaft der Religion befreit, ist auch bereit, „auf ein gutes Stück unserer infantilen Wünsche zu verzichten“, so dass man es auch erträgt, „wenn sich einige unserer Erwartungen als Illusionen herausstellen“.
Obwohl Freud von seiner hochgeschätzten Wissenschaft wusste, „dass sie heute als Gesetz verkündet, was die nächste Generation als Irrtum erkennt und durch ein neues Gesetz von ebenso kurzer Geltungsdauer ablöst“, verteidigte er sie vorbehaltlos: „Die Wandlungen der wissenschaftlichen Meinungen sind Entwicklung, Fortschritt und nicht Umsturz.“
„Nein“ sagt er abschließend, „unsere Wissenschaft ist keine Illusion. Eine Illusion aber wäre es zu glauben, dass wir anderswoher bekommen könnten, was sie uns nicht geben kann.“
Nachworte
Es ist erstaunlich, dass sich nach den schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, die ja Sigmund Freud selber nicht nur zu großem Ruhm kommen ließen, sondern ihn auch ins Exil trieben, noch immer Fortschrittsglauben, Machbarkeitswahn und Atheismus so ungeniert ausbreiten können, also jene Attribute, die sowohl das rote als auch das braune Terrorregime deutlich charakterisierten.
Es gäbe unendlich viel zu erwidern, aber das ist nicht meine Aufgabe. Nur noch ein Zitat des katholischen Querdenkers Hans Küng (geb. 1928) soll die Arbeit abrunden: „Nicht, dass der Gottesglaube psychologisch erklärt werden kann, ist das Problem. Psychologie oder nicht Psychologie ist hier eine falsche Alternative. Psychologische gesehen weist der Gottesglaube immer Strukturen und Gehalte einer Projektion auf oder kann als reine Projektion verdächtigt werden. Auch jeder Liebende projiziert notwendig sein eigenes Bild auf seine Geliebte. Aber heißt das, dass seine Geliebte nicht existiert oder nicht doch wesentlich so existiert, wie er sie sieht und sich denkt? Kann er sie mit seinen Projektionen nicht vielleicht tiefer erfassen als der, der sie als neutraler Beobachter von außen zu beurteilen sucht? Das Faktum der Projektion also entscheidet nicht über Existenz oder Nicht-Existenz des Objekts, auf das sie sich bezieht.“