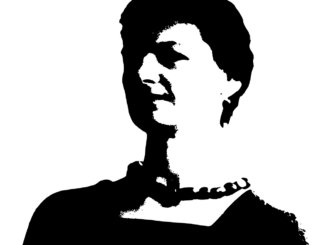Anfang Februar 2019 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD zu einem sogenannten Prüffall erklärt und sowohl ihre Nachwuchsorganisation, die Junge Alternative, wie das um den Thüringer AfD-Fraktions- und Landesvorsitzenden Björn Höcke gebildete Netzwerk „Der Flügel“ zum Verdachtsfall erklärt. Dazu müssen „tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ vorliegen. Das Amt sieht einen Verstoß gegen die Menschenwürde, „wenn in völkisch-nationalistischer Weise allein das Überleben des Volkes als Organismus zum Ziel des politischen Handelns gemacht wird, hinter dem die Interessen des Einzelnen vollständig zurückzutreten haben. Dies gilt insbesondere, wenn ein solches Konzept mit einem biologisch-rassistischen oder ethnisch-kulturellen Volksbegriff verbunden wird, der bestimmte Menschen qua Geburt und Natur nach aus dem Volk ausschließt“.
Die entscheidenden Reizworte um alles, was politisch rechts ist oder sein soll, sind hier in zwei Sätzen versammelt: Volk als Organismus, völkisch-nationalistisch, biologisch-rassistischer oder ethnisch-kultureller Volksbegriff. Unbeschadet der Tatsache, dass der Verfassungsschutz rechtlich und politisch besser darauf verzichtet hätte, einen „Prüffall“ zu Gegenstand öffentlicher Darstellung zu machen, hat er tatsächlich zu prüfen, ob Verständnis und Gebrauch des Volksbegriffs durch die AfD zentrale Schutzgüter des Grundgesetzes verletzen. Zu diesen tragenden Säulen des demokratischen Verfassungsstaates gehört ohne jeden Zweifel die Gleichbehandlung aller Staatsbürger ohne Rücksicht auf Abstammung, Rasse, Sprache, Glauben, Heimat und Herkunft, wie das Grundgesetz unmissverständlich klarstellt. Von den mit der Staatsangehörigkeit abgesehenen Differenzierungen gilt das Diskriminierungsverbot gegenüber jedem.
Die politische Auseinandersetzung birgt allerdings die Gefahr, dass die ethnisch-kulturelle Variante des Volksbegriffs als politisch und historisch kontaminiert völlig aus der Debatte verschwindet oder nur noch in stigmatisierender Absicht gebraucht wird. Das wäre fatal, weil es damit nahezu unmöglich wäre, einen Teil unserer sozialen Wirklichkeit zu beschreiben, wesentliche Bestimmungsfaktoren der Integrationspolitik ausgeblendet würden und man nicht zuletzt Rechtsradikalen die inhaltliche und politische Bewirtschaftung dieser Begriffe überließe. Denn ein Satz wie „jeder, der einen Anspruch hat, dauerhaft hier zu leben, ist ein Teil des Volkes“, taugt weder als Zustandsbeschreibung noch als politisches Programm.
In einer Zeit, in der zahlreiche Menschen in ganz Europa, auch in Deutschland, Fragen der kulturellen Identität ihrer Staaten und des nationalen Selbstverständnisses bewegen, wäre es vielmehr notwendig, Schlüsselbegriffe wie Volk, Nation und Staat neu ins Verhältnis zu setzen und ihren Gehalt für unsere Gegenwart zu bestimmen, statt sie peinlich zu vermeiden. Dies soll im Folgenden geschehen. Angefangen bei der der gedanklichen Unterscheidung zwischen dem Volk als Staatsvolk (Demos) und ethnisch-kultureller Kategorie (Ethnos), über die Nation als politischer Willensgemeinschaft bis hin zu der Frage, auf welches Ziel hin Integration ausgerichtet sein sollte, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu wahren und Deutschland als handlungsfähige, sich ihrer selbst bewusste Nation zu erhalten.
Volk als Begriff im Staats-, Völker- und Europarecht
Vergleichsweise einfach, aber politisch folgenreich ist die Feststellung, dass das Volk im Sinne des Grundgesetzes das Staatsvolk ist. Über die Zugehörigkeit entscheidet einzig und allein die Staatsangehörigkeit. Auf dieser Ebene geht es um das Verhältnis von Bürger und Staat und der Bürger untereinander in allem, was ihren Status als Staatsbürger berührt. Das Staatsvolk muss klar definiert sein, weil davon politische Teilhaberechte, wie etwa das aktive und passive Wahlrecht zum Bundestag, Verpflichtungen und politische Verantwortlichkeiten abhängen. Die moderne Demokratie ist ohne einen Staat mit einem klar umrissenen Staatsvolk nicht möglich. Für ethnische Differenzierungen hinsichtlich der Bürgerrechte lässt die Verfassung keinen Raum. Befassen sich das Bundesverfassungsgericht oder der Verfassungsschutz mit rechtsradikalen Parteien, liegen hier die entscheidenden Streitfragen. Wenn etwa Björn Höcke verlangt, die politische Führung sei„lediglich den Interessen der autochthonen Bevölkerung verpflichtet“, so ist dies verfassungswidrig.
Gleichwohl ist die Frage nach einem gewissen Maß an kultureller Übereinstimmung nicht überflüssig. Denn damit das Staatsvolk politisches Subjekt sein kann, muss es in der Demokratie auch eine politische Kommunikationsgemeinschaft sein. Die kulturelle Übereinstimmung hat auch Einfluss auf das Maß an Freiheitlichkeit. Je umfassender und selbstverständlicher die miteinander geteilten Überzeugungen sind, desto weniger muss gesetzlich reglementiert und vorgeschrieben werden. Vor einem gemeinsamen kulturellen Hintergrund werden Regeln und Mehrheitsentscheidungen leichter akzeptiert. Viele kennen den unendlich oft zitierten Satz Ernst-Wolfgang Böckenfördes, dem zufolge der freiheitliche Staat von Voraussetzungen lebt, „die er selbst nicht garantieren kann“. Seltener zitiert wird die Konkretisierung: „Als freiheitlicher Staat kann er nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert.“
Die historische und politische Erfahrung zeigt hinlänglich, dass über diese kulturelle Übereinstimmung beziehungsweise gesellschaftliche Homogenität ohne Berücksichtigung ethnisch-kultureller Faktoren schlecht geredet werden kann. Zu diesen Bestimmungsfaktoren können Sprache, Abstammung, Kultur, Religion, geschichtliche Erfahrungen gehören, die ein Bewusstsein der Zusammengehörigkeit begründen. Daran ist politisch nichts Anrüchiges. Das Völker- und Europarecht nimmt darauf vielfach Bezug. Das gilt für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das sich auf ein Staatsvolk beziehen kann, aber selbstverständlich auch auf ein nicht staatlich verfasstes Volk, das dann wohl oder übel am besten in ethnisch-kulturellen Kategorien zu beschreiben ist.
Der Schutz der in diesem Sinne verstandenen Völker ist ein wesentliches Ziel der Vereinten Nationen. So stellte 1948 bereits Art. III der Völkermordkonvention die Absicht unter Strafe, „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Die UN-Deklaration über die Rechte nationaler oder ethnischer, religiöser oder sprachlicher Minderheiten von 1992 schichtet die Quellen der Identität ab und verpflichtet die Staaten gar, diese Identitäten zu fördern. Eine Resolution der Vereinten Nationen zu indigenen Völkern gestaltete das 2007 noch aus und spricht gar vom Recht aller Völker „sich als verschieden zu betrachten und als solche geachtet zu werden“. In ihrer Grundrechtscharta verpflichtete sich die Europäische Union 2007, ihre gemeinsamen Werte „unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten“ zu entwickeln. In Art. 22 Grundrechtscharta heißt es: „Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen.“
Nach Angaben der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN) leben in Europa mehr als 300 nationale Minderheiten oder Volksgruppen beziehungsweise Völker, die nie einen Staat gegründet haben. Dies bestätigt eindrucksvoll, dass die ethnisch-kulturellen Faktoren im Bereich des Minderheitenschutzes wie für das Selbstbestimmungsrecht der Völker von großer Relevanz sind. Es wäre grundsätzlich schwer zu begründen, warum der Anspruch, Sprache, religiöse, kulturelle oder historische Prägungen zu wahren, für eine Mehrheitsbevölkerung in einem Staat kein legitimes politisches Ziel sein soll. Jedenfalls dann, wenn die Grenzen der Verfassung wie die Menschenwürde, die Rechtsgleichheit aller Staatsbürger und die Diskriminierungsverbote eingehalten werden.
Ethnisch-kulturelle Identität, Nationalbewusstsein und Staatsangehörigkeit
Die große Zahl der Minderheiten, von denen rund 100 aus 33 Staaten in der FUEN organisiert sind, zeigt schon: Ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit und Staatsangehörigkeit stimmen oft nicht überein und müssen es auch nicht. Für den Zusammenhalt eines Landes ist am Ende entscheidend, was daraus folgt. Ethnisch-kulturelle Vielfalt wird meist dann zu einer Quelle der Instabilität, wenn die Bürger den gemeinsamen Staat nicht mehr als den ihren empfinden, weil er wesentliche Erwartungen enttäuscht. Das muss keineswegs so sein. Ausschlaggebend ist dafür am Ende häufig die nationale Identität, das Nationalbewusstsein. „Die nationale Identität ist unter den verschiedenen Identitäten diejenige, die sich auf den Staat als souveräne Entscheidungseinheit bezieht“, definiert der Freiburger Staatsrechtler Dietrich Murswiek diese Kategorie.
Es gibt jene Fälle, in denen Nation und Staat schon begrifflich zusammenfallen – „nation“ im Englischen und Französischen – und eine starke Zentralmacht der entscheidende Akteur ist. Es finden sich Beispiele, bei denen das Nationalbewusstsein an den Ethnos anknüpft und zur Bildung von Nationalstaaten führt, wie in Italien und Deutschland im 19. Jahrhundert. Der umgekehrte Weg hat Europa ebenso geprägt. Zu denken ist an die aus dem Zerfall der Habsburgermonarchie, des russischen und des osmanischen Reiches am Ende des Ersten Weltkriegs hervorgegangene Staatenlandschaft Ostmittel- und Südosteuropas, die ihrerseits durch heftigste Nationalitätenkonflikte gezeichnet war. Zu erinnern ist an den Zerfall Jugoslawiens und der Sowjetunion, aber auch die friedliche Trennung der Tschechen und Slowaken nach dem Ende des Ostblocks.
Die Geschichte Europas in der Neuzeit kann ohne den ethnisch-kulturellen Faktor gar nicht beschrieben werden, und für die Gegenwart gilt das vielfach genauso. Man denke nur an das schwierige Verhältnis von Flamen und Wallonen in Belgien oder, ganz aktuell, den Konflikt zwischen den Katalanen und dem spanischen Staat. Selbstverständlich gibt es auch Beispiele friedlichen Ausgleichs. Die Schweiz zum Beispiel, wo drei, mit den Rätoromanen vier ethnisch-kulturelle Gruppen seit langem in einer politischen Nation zusammenfinden. Für Deutschland können exemplarisch Sorben oder Dänen angeführt werden, die sich als ethnische Minderheiten verstehen, politisch jedoch selbstverständlich zur deutschen Nation gehören. Gerade weil Geschichte und Kultur eine so herausragende Rolle spielen, ist Hagen Schulze zuzustimmen: „Die Geschichte der europäischen Nationen, wie sie sich seit dem Ende des Mittelalters entwickelt haben, ist eine Geschichte von lauter Sonderwegen.“
Diese Geschichte der Nationen enthält allerdings auch eine deutliche Warnung, die vor dem Nationalismus. Wenn die Nation zum einzigen, allumfassenden Bezugspunkt des politischen Denkens und Handelns wird, wandelt sie sich allzu leicht zur politischen Religion, für die kein Opfer zu groß ist. Dann bleiben im Inneren die Menschen- und Bürgerrechte auf der Strecke, und im Außenverhältnis ist der Friede bedroht. Der völkische Nationalismus steigert diese Gefahr noch einmal, wenn die ethnisch-kulturelle Abstammungsgemeinschaft, gar noch mit rassischer Fundierung, das Staatsvolk, Nation und Staat zu völliger Identität verschmolzen werden sollen. Ausgrenzung und Diskriminierung, Vertreibung und Völkermord sind die Folgen. Die entsprechende Blutspur durchzieht die europäische Geschichte, bis hin zu den Genoziden beim Zerfall Jugoslawiens in den 1990er Jahren.
Staatsvolk und Nationalstaat im Grundgesetz
Wie stellt sich das Verhältnis von ethnisch-kultureller Abstammungsgemeinschaft, Staatsvolk und Nation im Falle Deutschlands dar? Zur Klärung lohnt ein Blick auf die Entstehung des Grundgesetzes, den Akt der Verfassungsgebung, in dem das „Deutsche Volk“ sich laut Präambel „kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt“ staatlich neu verfasst, für jene Deutschen mit handelnd, „denen mitzuwirken versagt war“. Der Parlamentarische Rat als verfassunggebende Versammlung forderte das „gesamte Deutsche Volk“ auf, „in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden“ – das war das Wiedervereinigungsgebot –, und er gab darüber hinaus dem Willen dieses Volkes Ausdruck, „seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen“.
Der Verfassungsgeber, das Subjekt, das sich hier 1949 eine neue Verfassung gibt, ist das deutsche Volk, das sich als deutscher Nationalstaat staatlich wieder verfasst. Deutsche im Sinne dieses Grundgesetzes sind nach dem seither unveränderten Art. 116 GG die deutschen Staatsangehörigen, aber auch deutsche Volkszugehörige und nach dem Abstammungsprinzip deren Nachkommen, die als Flüchtlinge oder Vertriebene Aufnahme finden. Diese Volkszugehörigkeit ist in § 6 Abs. 1 Bundesvertriebenengesetz auf geradezu idealtypische Weise ethnisch-kulturell mit ihrer subjektiven und objektiven Seite gefasst: „Deutscher Volkszugehöriger im Sinne dieses Gesetzes ist, wer sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird.“
Art. 116 GG führt nicht dazu, „dass der Volksbegriff des Grundgesetzes sich vor allem oder auch nur überwiegend nach ethnischen Zuordnungen bestimmt“, wie das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich festgestellt hat. Historisch ist die Einbeziehung der sogenannten Volksdeutschen der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg geschuldet. Unstrittig ist auch, dass die Bestimmung der Staatsangehörigkeit einem Gesetzesvorbehalt unterliegt und der Bundestag dabei einen weiten Ermessensspielraum hat. Ein vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gebilligtes Motiv für die Regelung der Staatsangehörigkeit ist etwa, die Übereinstimmung zwischen „den Inhabern demokratischer politischer Rechte und den dauerhaft staatlicher Gewalt Unterworfenen“ durch die Verleihung der Staatsangehörigkeit herbeizuführen. Die Auffassung, der Gesetzgeber „sei bei der Konzeption des Staatsangehörigkeitsrechts streng an den Abstammungsgrundsatz gebunden, findet demgegenüber im Grundgesetz keine Stütze“, so die Karlsruher Richter.
Das Staatsvolk des Grundgesetzes als historisches konkretes Subjekt
Doch was bedeutet es dann, die nationale und staatliche Einheit zu wahren? Also das zu tun, was der Verfassungsgeber ausdrücklich wollte. Davon, welches Volk sich 1949 staatlich neu verfasste, dürften die wenigen Mütter und vielen Väter des Grundgesetzes jedenfalls eine klare Vorstellung gehabt haben. Sie gründeten keinen neuen Staat, sondern gaben dem alten eine neue staatliche Ordnung. Einen Staat der sich selbst und dessen Bürger ihn mit überwiegender Mehrheit als deutschen Nationalstaat verstanden. Welches Selbstverständnis damit verbunden war, vergegenwärtigt eine kurze Erinnerung an die Geschichte der vorausgegangenen 150 Jahre.
Nahezu durchgängig ist der Wille eines sich über Sprache und Kultur definierenden Volkes erkennbar, gegen die kleinstaatliche Fürstenherrschaft, Restauration und äußere Widerstände demokratische Freiheit und nationale Einheit zu erringen. Angefangen von den Napoleonischen Kriegen, über das Wartburg-Fest 1817, den Vormärz und das Hambacher Fest von 1832, die Revolution von 1848/49 bis zu den Reichseinigungskriegen zwischen 1864 und 1870/71. Das am Ende nicht zu verwirklichende Ideal vor allem Liberaler und Nationalliberaler in der Nationalversammlung in der Paulskirche war 1848/49, alle Deutschsprachigen in einem großdeutschen Nationalstaat zu vereinen. Das Staatsangehörigkeitsrecht folgte seit 1913 im Kern dem Abstammungsprinzip. Wie ein Echo auf diese Geschichte liest sich noch der Art. 2 der Weimarer Reichsverfassung von 1919, der praktisch eine Öffnungsklausel für angrenzende deutschsprachige Gebiete enthält. Sie „können durch Reichsgesetz in das Reich aufgenommen werden, wenn es ihre Bevölkerung kraft des Selbstbestimmungsrechts begehrt“.
Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates, die 1948/49 das Grundgesetz erarbeiteten, hatten diese Geschichte und ein historisch-kulturell konkretes Volk vor Augen, das sich als Nationalstaat neu verfasste. Der Befund wird durch den Alleinvertretungsanspruch, die nie vollzogene vollständige völkerrechtliche Anerkennung der DDR und die rechtliche Privilegierung der Volksdeutschen beziehungsweise deutschen Spätaussiedler abgerundet. Im Grunde fügen sich die Friedliche Revolution in der DDR und die Wiedervereinigung Deutschlands 1989/90 in dieses Bild ein. Mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ forderten die Revolutionäre Freiheit und Demokratie, mit der Losung „Wir sind ein Volk“ bekräftigten sie die Nation als politische Willensgemeinschaft. Die Wiedervereinigung wurde staatsrechtlich als Einbeziehung der damit untergehenden DDR in den Geltungsbereich des Grundgesetzes vollzogen.
Verfassungsrechtliche Grenzen für die Veränderbarkeit des Staatsvolkes
Damals, 1990, wurde auch die Präambel des Grundgesetzes geändert. Die Formulierung, die „nationale und staatliche Einheit zu wahren“ verschwand. Doch ist sie damit nicht obsolet, denn sie drückt nach wie vor den Willen des Verfassungsgebers, der verfassunggebenden Gewalt (pouvoir constituant) aus. Das Staatsvolk hat sein in Art. 146 GG bekräftigtes Recht, sich eine neue Verfassung zu geben, nach eingehender öffentlicher Diskussion ausdrücklich nicht genutzt. Eine umstrittene Frage ist, ob sich daraus immanente Schranken für den Gesetzgeber als eine der verfassten Staatsgewalten (pouvoir constitué) ergeben. Etwa hinsichtlich des Umfangs der Migration, den Forderungen für eine wirksame Integrationspolitik oder bei der Ausgestaltung der Staatsangehörigkeit. Dietrich Murswiek argumentiert, dass die erst durch das Volk verfassten Staatsorgane dieses Volk nicht einfach nach Belieben umformen können. „Das Selbstbestimmungsrecht der Völker würde dann durch das Recht der Regierung zur Volkshervorbringung ersetzt. Die Regierung wäre nicht mehr vom Volk hervorgebracht, sondern das Volk von der Regierung. Das kann so nicht richtig sein.“
Der um eine zugespitze Formulierung selten verlegene Bonner Verfassungsrechtler Joseph Isensee etwa wertete die Einführung der doppelten Staatsangehörigkeit durch den Bundestag 1999 als „autoritative Umdefinition des deutschen Volkes“, als „so etwas wie ein Staatsstreich durch das Parlament“. Er argumentierte dabei nicht etwa mit kulturellen Einwänden gegen die damals vor allem begünstigten Türken, sondern bemängelte, dass jene ihre „nationale Identität“ gar nicht in der deutschen Staatsangehörigkeit suchen würden. Der entscheidende Punkt war für ihn der Verzicht auf die Integration in die deutsche Nation als politische Willensgemeinschaft, nicht etwa die türkische Herkunft. Die zahlreichen Anhänger des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland bestätigen Isensees Prognose auf beklemmende Weise.
Das Beispiel belegt die zentrale Bedeutung des Staatsangehörigkeitsrechts. Einmal eingebürgert, wird der neue Staatsangehörige Teil des Staatsvolks und ist damit Deutscher im Sinne des Grundgesetzes. Unabhängig davon, ob er integriert ist oder ein nationales Zugehörigkeitsgefühl entwickelt. Würde dies über längere Zeit hingenommen, stünde in der Tat über kurz oder lang die nationale und staatliche Einheit zur Debatte. Davon ist die Frage nicht zu trennen, wie viel historisch-kulturell geprägtes nationales Selbst-Bewusstsein, wie viel Homogenität vorhanden sein sollte, damit der deutsche Nationalstaat als deutscher überdauert und die notwendige Integration leisten kann. Denn „das freiwillige Bekenntnis zur Nation […] bleibt leer, wenn es sich nicht auf bestimmte grundlegende Gemeinsamkeiten beziehen kann“, wie der Historiker Peter Alter anmerkt.
Knapp ein Viertel der Einwohner Deutschlands hat inzwischen einen Migrationshintergrund. Jeweils zur Hälfte handelt es sich um deutsche Staatsangehörige und Ausländer. Zwei Drittel sind zugewandert, ein Drittel ist bereits in Deutschland geboren. Die Zukunft zeigt sich in der Geburtenstatistik: 39 Prozent der Unterfünfjährigen hatten 2017 bereits einen Migrationshintergrund. Die Geburtenzahl je Frau liegt bei Ausländern ein reichliches Viertel über jener der Deutschen. Rund 1,95 Millionen Deutsche haben eine weitere Staatsangehörigkeit. Gut fünf Millionen Einwohner Deutschlands sind Muslime, die allerdings ins Verhältnis mit den noch rund 47 Millionen Christen gesetzt werden müssen. Die regionale Situation stellt sich in Deutschland höchst unterschiedlich dar. Die Daten legen nah, bei weiterer Migration auf die Integrationskraft des Staates und der Gesellschaft und die Integrationswilligkeit und –fähigkeit von Zuwanderern zu achten. Die Duldung oder gar Förderung von Parallelgesellschaften läuft dem Gebot nationaler Einheit zuwider, die fortlaufende Hinnahme doppelter Staatsangehörigkeiten letztlich ebenso.
Deutsch sein in den Augen der Bevölkerung
Befragt man das Volk selbst, hat es dazu zwar keine einmütige, aber doch eine recht klar erkennbare Position. „Die Grundsatzfrage, ob deutsch sein heute vor allem eine Frage des Passes und der Haltung ist oder doch etwas mit Kulturtradition und Herkunft zu tun hat, fällt recht deutlich zugunsten der zweiten Meinung aus“, fand das Institut für Demoskopie aus Allensbach im Spätsommer 2016 in einer Erhebung zur Frage des nationalen Selbstverständnisses heraus. Die Befragten, verschlössen sich keineswegs gegen Einflüsse aus anderen Kulturen, so Thomas Petersen unter Verweis auf die hohe Akzeptanz von Pizzerien und Dönerbuden. Bei Dingen von „größerer kultureller Symbolkraft“, fielen die Antworten jedoch deutlich anders aus. „Dass Moscheen zum Leben in Deutschland dazugehören, fanden nur 19 Prozent der Befragten“, illustrierte er den Befund. 53 Prozent stimmten folgender Ansicht zu: „Wenn immer mehr Einwanderer nach Deutschland kommen, geht das, was Deutschland war, allmählich verloren“. Lediglich 30 Prozent meinten dies nicht. Und immerhin 76 Prozent erwarten: „Ausländer, die in Deutschland leben, sollten sich an der deutschen Kultur orientieren. Natürlich können sie ihre eigenen Bräuche, Sprache oder Religion pflegen, aber im Konfliktfall soll die deutsche Kultur Vorrang haben.“
Da Ostdeutschen häufig eine gegenüber Fremden besonders abweisende Einstellung attestiert wird, einige ergänzende Anmerkungen anhand des aktuellen Thüringen Monitor 2018. Beim Blick auf andere Kulturen als die angestammte zeigt sich vor allem Unsicherheit. Eine knappe Mehrheit von 53 Prozent sieht zwar eine Notwendigkeit, sich „den Wertvorstellungen und Maßstäben anderer Kulturen stärker öffnen müssen“ (A 36). Zugleich lehnt es etwa die Hälfte ganz oder überwiegend ab, dass Zuwanderer in Deutschland „ihren Lebensstil beibehalten dürfen, auch wenn er sich vom Lebensstil der Deutschen unterscheidet“ (A 38). Doch welcher ist das? Bemerkenswert ist, dass drei Viertel der Thüringer meinen, „wir sollten uns wieder stärker auf unsere Traditionen besinnen“ (A 103). So antwortet, wer diesbezüglich ein Defizit wahrnimmt. Während es eine gewisse Offenheit für Arbeitsmigration gibt (A 75), sind 72 Prozent ganz oder überwiegend der Meinung, dass Flüchtlinge nach dem Wegfall der Asylgründe in ihre Heimat zurückkehren sollten (A 108), wohl auch, weil 60 Prozent Asylbewerber und Flüchtlinge eher für nicht integrierbar halten (A 37).
Die Debatte um das Eigene und Fremde entzündet sich vor allem am Islam. Es zeigt sich eine bemerkenswerte Differenz zwischen der individuellen Ebene und dem öffentlichen Raum: Zwar fühlen sich 60 Prozent der Thüringer durch den Bau einer Moschee in der Nachbarschaft eher oder sehr gestört (A 79), doch knapp zwei Drittel sehen in einem persönlichen Zeichen des Bekenntnisses, dem öffentlichen Tragen von Kopftüchern, kein Problem (A 80). Eine relative Mehrheit von 43 Prozent hegt Zweifel, dass „die meisten in Deutschland lebenden Muslime“ die im Grundgesetz festgeschriebenen Werte akzeptiert – ein Fünftel traut sich kein Urteil zu – (A 93), doch daraus ergibt sich keine generelle Ablehnung muslimischer Zuwanderung. Zwei Drittel sprechen sich dagegen aus, Muslimen den Zuzug grundsätzlich zu verwehren (A 95). Die Bürger sehen in ihrer Mehrheit in dem oder den Fremden keine pauschale Bedrohung, sie sind auch nicht intolerant, hängen aber am Hergebrachten und wollen es bewahren.
Ein historisch-kulturell gestützter Verfassungspatriotismus
Abschließend sei danach gefragt, welche politischen Konsequenzen heute der Verfassungsauftrag haben könnte, die nationale und staatliche Einheit zu wahren, und welche Bedeutung ethnisch-kulturellen Aspekten dabei möglicherweise weiter zukommt. Die weitgehende Übereinstimmung der Staatsangehörigen mit den Deutschen als Kultur- und Abstammungsgemeinschaft, der vom Parlamentarischen Rat 1948/49 vorausgesetzt werden konnte, ist so nicht mehr und auf absehbare Zeit immer weniger gegeben. Die Annahme, das Eigentliche nationaler Einheit heute in einer deutschen Kultur- und Abstammungsgemeinschaft finden zu können, dürfte das Streben nach Zusammenhalt und Identifikation eher verhindern als befördern. Das „Einheits- und Identitätsbewusstsein“ der Nation als politischer Willensgemeinschaft muss sich auf anderes stützen. Im Grund geht es um zweierlei: Zum einen darum, die Nation als Raum der politischen und kulturellen Kommunikation zu erhalten, schon um der Demokratie willen, zum anderen darum, die historische Erzählung nicht abreißen zu lassen. Denn beides stiftet politisches Selbst-Bewusstsein. Dabei kann es nicht um Rekonstruktion gehen, sondern vielmehr darum, die Überlieferung als Bausteine für eine schöpferische Fortschreibung zu nutzen.
Naheliegend ist dafür nach Lage der Dinge der Verfassungspatriotismus, nicht etwa als Surrogat für ein umfassendes Nationalbewusstsein, aber ganz sicher als Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für eine Identifikation mit Deutschland. Patriotismus war ursprünglich nicht ein verschämter Begriff für ein positives Nationalbewusstsein, als der er heute gelegentlich erscheint, sondern verband Gemeinsinn, Bürgertugend und Staatsmoral. Patriotismus diente der Entwicklung und Festigung einer inneren Bindung an das Gemeinwesen. Er kann dies auch für die Zukunft leisten, und es gibt dafür im demokratischen Verfassungsstaat keine plausiblere Grundlage als die Verfassung, die allerdings gelebt und in kulturellen Konfliktsituationen auch behauptet werden muss. Im Mittelpunkt steht das Bürgersein, in deutlicher Abgrenzung gegen die multikulturelle Identitätspolitik von links genauso wie gegen kulturelle Homogenitätsphantasien von rechts außen. Diese auf politische Identifikation zielende Teilhabe muss freilich gewollt und gefördert werden, ganz bewusst unter „Einbeziehung der Neubürger in die allgemeine Selbstvergewisserung der Nation.“ Hier hat die Integrationspolitik ihre Defizite.
Auf zweifache Weise kommen Sprache, Kultur und historische Erfahrung letztlich doch wieder ins Spiel, die den ethnisch-kulturellen Volksbegriff zwar nicht erschöpfen, jedoch zu seinen wesentlichen Inhalten gehören. Die eine Seite betrifft die Einsicht, dass auch Verfassungen nicht voraussetzungslos sind. „Entgegen einem weit verbreiteten Missverständnis heißt `Verfassungspatriotismus´, dass sich die Bürger die Prinzipien der Verfassung nicht allein in ihrem abstrakten Gehalt, sondern konkrete aus dem geschichtlichen Kontext ihrer jeweils eigenen nationalen Geschichte zu eigen machen“, so Jürgen Habermas in einer Diskussion der oben zitierten These Böckenfördes. Die zweite Seite kann als Appell an all jene verstanden werden, die sich der deutschen Sprache und Kultur verbunden wissen, die unsere so widersprüchliche Geschichte als Erbe und Verpflichtung annehmen. Mehr denn je kommt es darauf an, ebenso selbstbewusst wie einladend zur Sprache zu bringen, was Deutschland ausmacht, was es vor dem Hintergrund seiner historischen Erfahrung sein kann und sein will, um die nächsten Kapitel der deutschen Geschichte schreiben zu können. Wenn wir uns einreden oder einreden ließen, sie sei keine deutsche mehr – dann freilich wird sie es auch nicht mehr sein. Wer dergleichen propagiert ist alles Mögliche, aber ganz sicher kein Patriot.