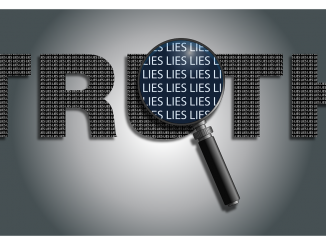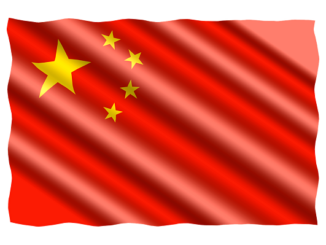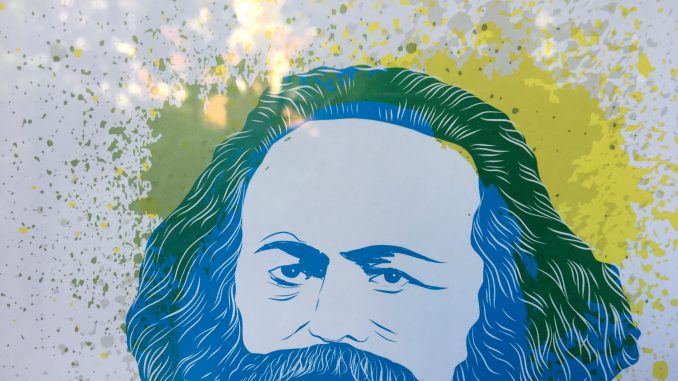
„Was würde Marx wohl dazu sagen?“
Man kann nur spekulieren, wie oft diese Frage in unserem Land gestellt worden ist. Ob in den Klassenzimmern der DDR, wo sie buchstäblich jedes Fach durchtränkt hat, wie Ingo Schulze beschrieben hat. Ob, lieber Jürgen Neffe, in den Lesezirkeln westdeutscher Universitäten, oder – so habe ich es selbst erlebt – als Eignungstest vor dem Eintritt in eine Studenten-WG der 1970er Jahre.
Und heute? „Was würde Marx wohl dazu sagen“, wenn er in diesen Saal schauen würde? Ein Gespräch zu seinem Gedenken, ausgerechnet im Schloss Bellevue – schwere Teppiche, goldene Lüster und Porträts preußischer Könige.
Ehrlich gesagt: Führe ich mir das äußerst spitze Ende seiner Feder vor Augen, das wir aus seinen Briefen und Polemiken kennen, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir die Antwort nie erfahren werden.
Eine Annäherung höchstens bietet uns sein Berlin-Besuch 1861: Wenige hundert Meter von hier entfernt logiert Marx mondän bei seinem vermeintlichen Verbündeten und tatsächlichen Intimfeind Ferdinand Lassalle. Keine zehn Pferde würden ihn dazu bewegen, so schreibt er von hier seiner Cousine nach Holland, „nach Deutschland zu gehen und noch weniger nach Preußen und am allerwenigsten nach diesem [abscheulichen] Berlin mit seinem ‚Sand‘ und seiner ‚Bildung‘ und ‚seinen überwitzigen Leuten‘.“
Den darauffolgenden Satz hätte man fast auf unsere Einladungskarte drucken können: „In Berlin ist natürlich jeder, der etwas Geist zu verspritzen hat, außerordentlich begierig nach Leidensgefährten.“ In diesem Sinne: Herzlich Willkommen im Schloss Bellevue Ihnen allen!
„Was würde Marx dazu sagen?“ ist heute glücklicherweise nicht unsere Fragestellung, sondern die umgekehrte: „Was haben wir hier und heute über ihn zu sagen?“
Ich freue mich auf die Ansichten eines facettenreichen Podiums – mit dem kritischen Blick einer liberalen Ökonomin, Karen Horn, mit der Lebenserfahrung und dem Gedankenreichtum des Dresdner Schriftstellers Ingo Schulze, und, lieber Ranga Yogeshwar, mit der Zukunftsperspektive Ihres neuen Buches, das in Digitalisierung und Robotisierung Umbrüche von – darf ich das sagen? – geradezu Marxschem Ausmaß erkennt. Die umfassende Vorstellung dieses Podiums will ich dem wunderbaren Moderator dieses Vormittages überlassen – dem Marx-Biographen, Journalisten und Autor Jürgen Neffe. Sie alle, unsere vier Panellisten, möchte ich ganz besonders herzlich begrüßen, und ich glaube, ich kann für den ganzen Saal sagen: Wir sind gespannt auf Ihr Gespräch – herzlichen Dank fürs Kommen!
Was also haben wir über ihn zu sagen? Wenn ich selbst den Ball unserer Diskussion ins Rollen bringen darf, dann will ich mit der Feststellung beginnen: Karl Marx war, in all seiner Widersprüchlichkeit, jedenfalls das: ein großer deutscher Denker.
Denker war er vor und über all den anderen Aspekten seines vielgestaltigen Lebens: Ökonom, Historiker, Soziologe und Philosoph; Journalist und Chefredakteur; Politiker, Arbeiterführer und Pädagoge; Flüchtling und politisch Verfolgter; Kommentator und Briefeschreiber, heute würde man wohl sagen „Netzwerker“; Teil eines einzigartigen Kreativ-Duos mit Freund Engels; und natürlich Familienvater und Jenny Marxens Ehemann. Sein Denken aber überragt dieses Leben – seine politischen Gehversuche hingegen ließen ihn zumeist enttäuscht, frustriert, gekränkt zurück. Mehr folgenreich als erfolgreich, so könnte man das nennen.
Gewaltig ist das Werk, das er hinterlassen hat. Gewaltig in seiner Schaffenskraft, opfer- und entbehrungsreich der Entstehungsprozess, gezeichnet über lange Phasen seines Lebens von bitterer Armut, familiären Schicksalsschlägen und schwerer Krankheit. Gewaltig ist es auch in seiner sprachlichen Kraft, seiner literarischen Spannbreite. Gewaltig bis teils unverständlich in seiner Komplexität – so dass die Zaristische Zensur die erste russische Ausgabe des Kapitals mit der Begründung passieren lässt: „Nur wenige werden es lesen, noch weniger werden es verstehen.“ Welch folgenreicher Behördenirrtum!
Gewaltig will ich auch seinen Geltungsanspruch nennen, seinen Ehrgeiz, die Absolutheitsambition seiner Gedankenwelt. Marx war ein kategorischer Denker, und seine Kategorien waren sehr starr. Marx war vernichtend in seiner Kritik an Ideen und noch vielmehr an Personen. Immer wieder blitzen die Momente radikalen Eiferns auf, schwarz und weiß in einer Weise, die heutige Leser befremdet zurücklässt – die aber jahrzehntelang, wie etwa die dröhnende Fanfare von der „revolutionären Diktatur des Proletariats“, im Osten unseres Landes in Dauerschleife zu hören waren, und die, ausgesprochen oder nicht, als Rechtfertigung für Gängelung und die kleinen und großen Beschränkungen von Freiheit dienten.
Und doch, das spürt man in den weit verzweigten Texten, hat alles Eifern, alle Rastlosigkeit und Heftigkeit dieses Autors einen Kern, eine innere Triebkraft, und die liegt in den Verhältnissen seiner Zeit: Es geht ihm um die Überwindung des massenhaften Elends, um die Befreiung aus Armut und Bevormundung, aus der eisernen Hand des Obrigkeitsstaats.
Sein Werk ist durchzogen von einem leidenschaftlichen Humanismus: Da gibt es Appelle für die Pressefreiheit, für humane Arbeitsbedingungen und den Acht-Stunden-Tag, für die Bildung der arbeitenden Schichten, für die Wertschätzung von Frauen im Freiheitskampf bis hin zum Plädoyer für Umweltschutz – dass wir nämlich nicht „Eigentümer der Erde“ seien, sondern lediglich ihre „Nutznießer […] [und sie] verbessert den nachfolgenden Generationen zu hinterlassen“ haben. Es finden sich sogar Freiheitselogen, die bis heute nicht sprachmächtiger und bewegender beschreiben könnten, was eine auf den Prinzipien der europäischen Aufklärung gegründete Gesellschaftsordnung ausmacht. All das brachte Willy Brandt 1977 zu seinem Urteil: „Was immer man aus Marx gemacht hat: Das Streben nach Freiheit, nach Befreiung der Menschen aus Knechtschaft und unwürdiger Abhängigkeit war Motiv seines Handelns.“
Allein: „Was immer man aus Marx gemacht hat“ – das ist kein ganz unbedeutender Nebensatz. Gewaltig ist nicht nur sein Werk, sondern gewaltig sind seine Folgen. Auch wenn wir sein Diktum „Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin“ noch im Kopf haben mögen, so ist es für uns, die wir zurückblicken, mit einer schnell dahingesagten Trennung von Marx und Marxismus, dem Denker und seiner Wirkung, nicht getan. Ein Wort zumindest drängt sich mir auf, und das ist Verantwortung. In der „Verantwortung“ steckt ja das „Wort““– und mit dem Wort wollte er seine Nachwelt prägen, und hat sie geprägt.
Und auch das: gewaltig. Um nur ein Beispiel zu nennen: In einem Briefentwurf von 1881 an die Russin Vera Sassulitsch heißt es: „Also ist etwas Neues notwendig: das Gemeineigentum abschaffen, […] und die große Mehrheit der Bauern in gewöhnliche Proletarier umwandeln.“ Gerade mal zwei Zeilen Marx, von ihm selbst verworfen und nie ins Kuvert gesteckt, die aber posthum in den Händen leninistisch-stalinistischer Revolutionäre herhielten für Enteignung, Umsiedelung, Zwangsnivellierung von Abermillionen russischer Bauern.
Bleibt die Frage: Wie weit ist er, der Weg von der Wortgewalt zur tätlichen Gewalt, vom glühenden Gedanken zum fanatischen Handeln? Die Arbeit an dieser Frage – wie an der gesamten Marxschen Wirkungsgeschichte – bleibt notwendig. Je mehr wir über ihn in Erfahrung bringen, je mehr wir ihn und seine Zeit verstehen, desto eher mag es gelingen, den vielfältigen Legendenbildungen etwas entgegenzusetzen. Das tut die neue Landesausstellung in Trier, die dieser Tage eröffnet wird und deren Schirmherrschaft ich gern übernommen habe. Denn ich glaube: Wir wären schlecht beraten, denen das Feld der Deutung zu überlassen, die ihn ideologisch vereinnahmen oder absichtsvoll missverstehen. Das ist in der Geschichte schon zu oft mit Marx passiert. Wenn wir dem entgegenwirken, dann muss die notwendige Aufarbeitung des Marxismus einer Offenheit für Marx nicht entgegenstehen.
Und diese Offenheit wünsche ich uns. Ich jedenfalls finde: Der 200-Jährige hat uns verblüffend viel zu sagen über unsere Zeit. Über diesen, den aktuellen Marx, ist viel zu lesen in diesen Tagen, und darüber werden wir, so hoffe ich, einiges von unserem Podium erfahren:
Über Marx, den Analysten der ökonomischen Konjunktur, von Krisen und insbesondere Finanzkrisen, wie sie die Weltwirtschaft vor zehn Jahren an den Abgrund getrieben haben.
Über Marx und die Gleichzeitigkeit von großen ökonomischen Erkenntnissen und folgenreichen Irrtümern, wie Hans-Werner Sinn sie kürzlich beschrieben hat.
Über Marx, den Anatomen des Kapitals, der galoppierenden Ungleichheit, wie sie Thomas Piketty und andere untersuchen, der Ausbreitung der Marktlogik in alle Lebensbereiche, wie wir sie bis in unsere Alltagssprache hinein beobachten, von der „Selbstoptimierung“ bis zu den „Bildungsinvestitionen“ – die „Vergötzung des Marktes“, wie Papst Franziskus sie in durchaus Marxscher Sprachfärbung benannt hat.
Und nicht zuletzt über den bestechenden Prognostiker der Globalisierung. Nur eine Kostprobe: „In wenig Jahren werden wir eine Dampfpaketlinie haben von England nach Chagres, von Chagres und San Franzisco nach Sydney, Kanton und Singapore. […] Dann wird der [Pazifische] Ozean dieselbe Rolle spielen wie jetzt der Atlantische […], und der Atlantische Ozean wird herabsinken zur Rolle eines Binnensees, wie sie jetzt das Mittelmeer spielt.“ Nein, nicht aus einem aktuellen Thinktank-Papier über den „Pivot to Asia“, sondern Karl Marx 1850. Heute allerdings müsste man die „Dampfpaketlinie“ durch „Tiefseedatenkabel“ ersetzen.
Für mich ist vielleicht der spannendste aller, wenn Sie so wollen, „Teil-Marxe“ der Vordenker der technologischen Entwicklung. Gewiss ist: Karl Marx hat die Grundbegriffe des Industriezeitalters geprägt. Die Frage ist: Kann er uns auch noch die Stichworte für die nächste Epoche liefern?
Natürlich waren „Big Data“, „Artifical Intelligence“ oder „Social Media“ keine Kategorien des 19. Jahrhunderts. Aber Marxsche Zukunftsfragen stellen sich heute drängender denn je: Entfremdung oder Befreiung? Mehr Überwachung und Kontrolle durch Big Data? Mehr Markt- und Machtkonzentration durch die Big Five der Datenökonomie – oder mehr Chancengleichheit dank digitaler, frei zugänglicher Ideen rund um die Welt? Mehr Fremdbestimmung, wenn der Algorithmus meine Interessen und Vorlieben besser kennt als ich selbst? Oder mehr Selbstbestimmung, wenn Roboter uns von körperlicher Arbeit befreien?
Lesen wir einen Marx-Satz wie diesen: „Da der Arbeiter zur Maschine herabgesunken ist, kann ihm die Maschine als Konkurrent gegenübertreten“, dann könnten wir heute nahtlos anfügen: Wenn die Maschine zum Arbeiter aufsteigt, kann sie das erst recht. Sind wir also zurück beim Historischen Materialismus, beim Zauberlehrling Mensch, dem seine Erfindung entglitten ist?
Jürgen Neffe hat letzte Woche in der ZEIT einen neuen „Marxschen Moment“ beschrieben. Gewiss, immer schnellere Wellen technologischer Disruption stehen uns bevor – und Marx mag uns helfen, rechtzeitig die richtigen Fragen zu stellen, die heute noch zu selten gestellt werden. Aber: Ich halte nichts von deterministischen Zukunftsentwürfen. Dieser Moment muss nicht in neue Abhängigkeit führen, sondern es öffnen sich ebenso Wege zu mehr Selbstbestimmung und weniger Entfremdung, zu mehr Teilhabe und weniger Ungleichheit. Auf diese offene Frage gibt es keine letzten Antworten, auch nicht von Marx. Sondern ob das gelingt, dafür ist etwas anderes entscheidend, eine Größe, der Marx stets zu wenig zugetraut hat: die Demokratie nämlich – und das Selbstbewusstsein, mit dem wir uns als Demokraten in einer Sozialen Marktwirtschaft die Gestaltung unserer Zukunft zutrauen!
Marx sagt: „Die Ausgeburten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen. Vor ihren Geschöpfen haben sie, die Schöpfer, sich gebeugt“. Ich finde: Das Zeitalter von Robotern und Künstlichen Intelligenzen ist ein guter Moment, um Marx das Gegenteil zu beweisen.
Erlauben Sie mir, dass ich am Ende auf das dritte der eingangs genannten Attribute eingehe, eines, das mir als Bundespräsident besonders wichtig erscheint: Ja, er war ein deutscher Denker. Karl Marx ist ohne deutsche Geschichte nicht denkbar – und deutsche Geschichte wohl nicht ohne ihn.
Karl Marx ist nicht denkbar ohne den Preußischen Obrigkeitsstaat und Bismarcks eiserne Hand, ohne die Freiheitsluft des Vormärz, ohne das Hambacher Fest und die zertretenen Hoffnungen der Revolution.
Er ist nicht denkbar ohne das menschliche Elend der frühen Industrialisierung und ohne die Armut auf dem Land, wie er sie als junger Mann schon leidenschaftlich anklagt, am Beispiel der „Raffholzsammler“, denen die Privatisierung des Waldeigentums ihre dürre Lebensgrundlage geraubt hat.
Er ist auch nicht denkbar ohne die wechselvolle Geschichte des deutschen Judentums, ohne seine Absage an die eigene Herkunft, ohne sein Hadern und Eifern gegen das Judentum – in dessen schärfsten Ausfällen die späteren deutschen Dämonen schauerlich vorausklingen.
Marx ist nicht denkbar ohne seinen Internationalismus, seinen weltgewandten Blick, in Abgrenzung zu dem von ihm verachteten Preußen.
Er ist nicht denkbar ohne Flucht und Vertreibung aus Deutschland, den Verlust der Staatsangehörigkeit, ohne – in Engels‘ Worten – die „schlaflose Nacht des Exils“.
Kurz: Marx ist nicht denkbar ohne sein Leiden an Deutschland.
Gerade deshalb, gerade in dieser Widersprüchlichkeit, sollten wir ihn sehen als großen deutschen Denker. Und das können wir, denn wir sind ein Land, für das es geradezu identitätsstiftend ist, die Widersprüche unserer Geschichte anzunehmen, die Abgründe neben den geistigen Höhen.
Diese Ambiguität gibt es im Falle Marx vielleicht in besonderer Weise im Osten unseres Landes. Ich habe Ostdeutsche getroffen, die beides sind: froh, ihn los zu sein – den Marx, mit dem die ganze Unfreiheit des SED-Regimes verbrämt wurde. Und doch zugleich hoffend, dass ein anderer Marx noch viel zu sagen hat: über die Gefahren eines ungezügelten Kapitalismus und über die Möglichkeiten einer gerechteren und humaneren Ordnung.
Ich glaube: Wir Deutschen, im Jahr 2018, sollten Karl Marx weder überhöhen noch aus unserer Geschichte verbannen. Wir müssen uns vor Marx nicht fürchten – noch müssen wir ihm goldene Statuen bauen. Marx soll streitbar bleiben.
Das könnte Sie auch interessieren: